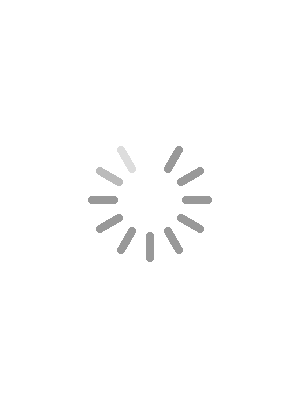
Golo Föllmer
Klingt Onlineradio anders?

Wie alle Massenmedien steckt das Radio in einem medialen Umbruch. Das Internet, aber auch andere digitale Technologien — allen voran das Smartphone — verändern vor allem eines: Die Erwartungen, die Hörer (oder Nutzer) an das Medium stellen. Das kommt daher, dass vor allem junge Leute sich heute anders durch die Welt bewegen, sie anders wahrnehmen, anders kommunizieren, sich anders informieren und unterhalten lassen. Marshall McLuhans alte Medienregel gilt nämlich auch für den Übergang des Radios ins Digitale: Jedes neue Medium wird nach McLuhan erst einmal so benutzt, als sei es das Vorgängermedium. Ein Beispiel dafür ist der Büro-Computer, der anfangs als elektronische Schreibmaschine missverstanden wurde. Erst später begriff man, sein Potential wirklich auszunutzen, indem man multimediale Elemente miteinander verknüpfte, Datenbestände vernetzte oder Menschen und automatische Prozesse interagieren ließ. Beispiele dafür sind Computerspiele, eLearning-Angebote, aber auch das Hypertextprinzip. Beim Online Radio ist dieser McLuhan-Effekt auch nach 15 Jahren verschiedenster Experimente und fünf Jahren rapider Etablierung von Webradios noch deutlich zu spüren: Die am meisten online gehörten Angebote sind nach wie vor entweder so genannte Simulcasts, also die parallele Verbreitung klassischer UKW-Programme über das Netz. Oder es sind online-only-Radios, die bloße Musik-Streams senden, was zwar manchem Dudelfunker ähnelt, aber die Stärken des Radios nicht ausspielt. Was ist Radio? Ökonomisch gesehen ist Radio ein Breitenmedium, d.h. es kann umso effizienter betrieben werden, desto mehr Hörer sich zuschalten. Die Stärke des Netzes liegt ganz im Gegenteil darin, dass es Nischeninteressen bedienen kann — den so genannten Long Tail — und dass es einen kommunikativen Rückkanal besitzt. Das funktioniert besonders gut in überschaubaren Communities, d.h. bei Gruppen, die sich aus welchen Gründen auch immer einander nah fühlen. Das klassische Radiopublikum setzt sich dagegen viel heterogener zusammen. Die zwei Modelle Radio und Netz sind an diesem wesentlichen Punkt nicht kompatibel. Was ist das Radio noch? Radio ist ein Begleitmedium, Hintergrund, Tapete. Begleitung zu was? Andy Warhol nannte einmal den Film als ein Beispiel dafür, dass Medieninhalte viel weniger bedeutsam sind, als man annehmen könnte. Nach Warhol gehen die Leute nicht ins Kino, um den Film zu sehen, sondern um in der Schlange zu stehen. Übersetzt heißt das: Der Film ist nicht der Zweck, sondern das Mittel, also bloßer Anlass für Kommunikation, für Prozesse sozialer Ordnung, für die Bildung von Identität, für den Austausch von Gefühlen. Beim Radio ist dieser Warhol-Effekt vielleicht noch ausgeprägter als beim Film: Die Leute hören häufig weniger den Inhalten zu, sondern wollen live dabei sein (wobei auch immer), wollen sich in der sonoren Stimme des Moderators aufgehoben fühlen, wollen sich mental mit anderen Hörern synchronisieren. Einige Jugendwellen versuchen, dem mit den Mitteln digitaler Medien gerecht zu werden. Die Integration von Radio und Social Media könnte in diesem Argument seine Begründung finden: Der Sender, mit dem ich mich identifiziere, gehört zu den Insignien meiner Identität, die ich auf Facebook zur Schau stelle, um den gegenwärtigen Zustand meiner Persönlichkeit anderen mitzuteilen. Aus der Inkompatibilität des Radiomediums und des Netzmediums ergibt sich aber oft die Schwierigkeit, dass der Einzelne auf seine Interaktion mit den Radiomachern keine Rückmeldung erhält, wenn viele gleichzeitig interagieren. In der Psychologie spricht man dann von einem Manko an wahrgenommener Selbstwirksamkeit: Drücke ich einen Knopf und bekomme darauf keine Reaktion, so zweifle ich am Sinn meines Knopfdrückens. Der Kommentar, der Protest, der Beitrag des Hörers muss also etwas bewirken, im Zweifel auf Sendung gehen. Aber wievielen Hörern kann ich als Sender diese Selbstwirksamkeitserfahrung bieten? Eine Lösung könnte sein, dass ein »Radioprogramm« auf jeder technischen Plattform jeweils andere Funktionen bietet, in jedem Distributionskanal anders wirkt. Im einen stünde Aktualität im Vordergrund, im anderen vielleicht die journalistische Qualität: Ein Angebot, dass tatsächlich die Konzentration auf Inhalte besonders gut möglich macht. Im nächsten läge der Fokus womöglich auf der Qualität der sozialen Interaktion, im anderen auf der Immersivität des Interfaces, also auf der Erfahrung flüssiger und wirkungsvoller Interaktion mit den Bestandteilen des technischen Systems. Zwei wesentliche Fragen treten dabei zutage. Die eine bezieht sich auf das Modell, bei dem Hörer Programm machen: Kommentare, Beiträge, ja ganze Sendungen gestalten. Manche alten Hasen unter den Radioprofis belächeln diese Angebote, weil sie journalistische Professionalität und das, was sie unter Qualitätsjournalismus verstehen, nicht erfüllt sehen. Sie übersehen dabei, dass dafür die Ansprache von Spezialinteressen (des Long Tail), die soziale Synchronisation der Hörer und eben das Gefühl der Selbstwirksamkeit so gut gegeben ist, wie es keine klassische Radiowelle leisten kann. Daraus folgt, dass sich der Stellenwert von Professionalität als Merkmal medialer Qualität radikal verändern wird: Die Qualität eines Radioprogramms wird sich in Zukunft, zumindest für ein bestimmtes Segment von Angeboten, zunehmend über die Merkmale Nischeninteressen, soziale Bindung und Selbstwirksamkeitserfahrung definieren. Die zweite große Frage, die sich stellt, lautet: Kann das Radio dabei überhaupt noch ›Programm‹ im herkömmlichen Sinn bleiben? Ein Programm ist eine festgelegte Abfolge aus einerseits redaktionellen Inhalten wie Nachrichten, Talk, speziellen radiophonen Beitragsformen wie Feature und Hörspiel. Andererseits gehören zum Programm die Strecken dazwischen, nämlich Musik, Teaser, Jingles etc. Die radikalsten neuen Radiokonzepte, so genannte ›Personal Radios‹ wie last.fm, Pandora oder wah-wah.fm erlauben zwar flüssige Interaktion, ermöglichen die Bildung sozialer Zirkel und adressieren Nischeninteressen. Aber sie lassen den eigentlichen Radio-Teil weg: Das Redaktionelle. Ihnen fehlt der Beitrag, die Moderation, der Mensch, der dazu beigetragen hat, das der Radiohörer sich jahrzehntelang beim Radiohören aufgehoben fühlte. Die zwei wichtigsten Fragen lauten also: Wie kann das Radio den Schritt machen, redaktionelle Inhalte und die radiophone Stimme in das Personal Radio zu integrieren? Und zweitens: Wie können die Radio-Professionals konstruktiv damit umgehen, dass sie in Zukunft nicht mehr allein entscheiden, was die Qualität des Radios ausmacht, sondern zusammen mit ihren Hörern.
Online Radio
#1809 / O-Ton / mit Geodaten / Dokublog
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
