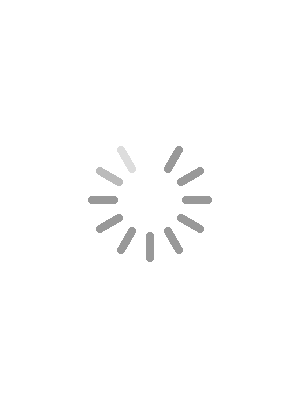
Das Radio muss sich in mehrere Richtungen entwickeln
von Felicia Reinstädt

Audio versus Onlinenutzung, Streaming versus on demand, Webradios versus Spotify, Amazon Echo versus Google Home.
Es gibt zahlreiche Schauplätze, auf denen sich die Zukunft des Hörens abspielt. Ob das Radio bei all dem noch mitspielen wird, hängt davon ab, wie sehr es sich noch verändern kann - und vor allem will. Geht es um die Frage nach der Zukunft des Radios, wird es schnell existenziell. Ich kenne Kollegen, die mit scheinbar ungetrübtem Optimismus an die Zukunft des Radios glauben, ich kenne aber auch Kollegen, die gerade mit Blick auf fallende Reichweiten in der jungen Zielgruppe eher skeptisch nach vorne schauen. Und ich beobachte einen weiteren interessanten Reflex: Geht es um die Zukunft des Radios, wird gerne über alles geredet - außer über das Radio selbst.
Überraschung statt Format
Kluge Menschen reden sich auf Zukunfts- und Innovations-Panels die Köpfe heiß und sind sich am Ende doch einig: Wenn das Radio überleben will, dann muss es sich zur multimedialen Medienmarke entwickeln. Es geht um Digital- und um Diversifizierungs-Strategien, neue technische Verbreitungsmöglichkeiten, crossmediale Arbeitsweisen, immer kürzer werdende Innovationszyklen, Seeding und SEO und weitere Buzzwords der heutigen Medienwelt. Alles richtig und notwendig, nur zielt das am Kern der Frage vorbei. Ob wir in 10, 20 oder 30 Jahren noch Radio hören werden, entscheidet sich nicht nur daran, ob es dem Radio gelingt, sein Angebotsspektrum im Digitalen auszubauen, sondern auch daran, ob es ihm gelingt, sich selbst noch mal so weit zu verändern, dass es im vollen Medienportfolio der Menschen weiterhin relevant bleibt. Eine Chance des Radios liegt hier tatsächlich in seiner Linearität und in seinem Selbstverständnis, es muss gar nicht mehr um die totale Aufmerksamkeit seines Publikums buhlen. Als Radiomacher ist man genügsam, passt sich dem Alltag seines Hörers an und gestaltet sein Programm so, dass dieser parallel dazu sich die Zähne putzen, Autofahren, den Abwasch machen und auch ganz andere Medienangebote nutzen kann. Radio funktioniert wunderbar als Second Stream, als zuverlässiger Tagesbegleiter, als Kumpel, der einem das Gefühl gibt, dass bei allem, was da draußen passiert, die Welt sich weiterdreht.
Linearität schafft hier klare Verhältnisse, strukturiert, bietet Vertrauen und liefert gleichzeitig neue Impulse. Sie bietet dem Hörer eine Mischung aus Erwartbarem und Überraschung, die weder zu sehr stört, noch zu sehr langweilt - quasi das Rezept, nach dem auch Empfehlungs-Algorithmen im Netz die Inhalte für ihren User vorselektieren. Jede Musik-Playlist, jeder persönliche Facebook-Stream, jede Youtube-Empfehlung funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip: Sie möchte dem User so viel Neues anbieten, wie er verträgt, und so viel Gewohntes liefern, wie er für sein Wohlbefinden braucht. Leider hat das Ganze einen Haken. Wenn man zu sehr auf das Erwartbare, das Bequeme, das, was vermeintlich alle mögen, abzielt, wird es schnell langweilig. Im Netz heißt das Filterblase, im Radio spricht man von Format. Radio- und Musik-Consulter haben hier in den letzten 20 Jahren einen guten Job gemacht und uns haargenau erklärt, was der Hörer von uns will, wie er es will und in welcher Regelmäßigkeit. Sie haben die Überraschung zugunsten der Durchhörbarkeit aus vielen Programmen verbannt und dafür eine gleichförmige Radiolandschaft hinterlassen. Fragt man Menschen auf der Straße, was sie unter Radio verstehen, bestätigen sie genau das. Radio ist für die meisten penetrant gut gelaunte Morningshow-Moderatoren, der beste Wetter- und Verkehrsservice, endlich Feierabend mit den immer gleichen besten Hits von heute und gestern und dazwischen ein Hörer-Gewinnspiel zum Meet & Greet mit Ed Sheeran oder für das neue iPhone X. Radio ist für viele zu einem Klischee geworden, mit dem es sich zwar aushalten lässt, das sich aber immer weiter von dem entfernt, was das Medium eigentlich sein möchte: nah dran am Menschen und seiner Lebenswelt. Das müssen wir ändern.
Im Alltag der Hörer verankert.
Nähe, Lokalität und Emotionalität sind die drei großen Schlagworte, die Radiomacher gerne für ihr Medium beanspruchen. Und es stimmt, Radio ist immer dann besonders erfolgreich, wenn es ein Gefühl transportiert, eine kollektive Stimmung aufgreift und im Alltag seiner Hörer verankert ist. Gerade in einer global vernetzten Welt liegt die Stärke des Radios in seiner zeitlichen Unmittelbarkeit und seiner regionalen Verortung. Der australische Radio-Futurologe James Cridland beschreibt Radio als "eine geteilte Hörerfahrung mit einer menschlichen Verbindung". Wir müssen aufpassen, dass diese Verbindung nicht abreißt. Wenn Radio weiterhin ein Gemeinschaftsgefühl produzieren will, dann kann dieses nur in einem ehrlichen Dialog mit der Hörerschaft entstehen. Dafür müssen wir unsere Hörer ernst nehmen, sie nicht nur zu vorgecasteten Stichwortgebern und Jubel-Adjutanten degradieren, sondern auch unbequeme Stimmen im Programm zulassen. Genau das macht Radio authentisch. Und diese Authentizität gilt es von Generation zu Generation neu zu definieren. Wenn sich Mediennutzung, Kommunikation und Sprache verändern, sollten wir auch unsere alten Radiospielregeln überdenken. Gerade in einer so perfekt geölten Maschinerie wie dem Radio, wo jeder weiß, was, wann wie zu tun ist, ist das nicht einfach, aber bitter nötig.
Wir müssen "die Klassiker" unserer Zunft hinterfragen wie: Braucht ein Sender wirklich noch feste Claims? Wie sieht es mit der Bejingelung und dem Teasing unserer Inhalte aus? Was ist mit der Länge oder der Kürze unserer Wortbreaks? Und repräsentieren die Moderatoren und ihre Lebenswelt wirklich noch die Menschen, die wir ansprechen wollen? Authentische Moderatoren In der Branche wird gerne gejammert, uns würden heute die großen Moderatoren-Persönlichkeiten von früher fehlen. Wir machen es dem Nachwuchs aber auch nicht leicht, zu sehr haben wir ein vorgefertigtes Bild im Kopf von dem, was wir vermeintlich brauchen: Wir möchten souveräne On-Air-Personalities, die das Image unseres Senders transportieren, unsere Musik verkaufen und unsere Inhalte positionieren, gut drauf und immer politisch korrekt sind, fehlerfrei im engen Formatkorsett funktionieren und auf Knopfdruck hohe Quoten einfahren und dabei ganz selbstverständlich sie selbst und doch wieder austauschbar sind. Dieses Bild des perfekten Konsensmoderators hat sich leider auch im Kopf vieler angehender Moderatoren festgesetzt. Dagegen müssen wir anarbeiten, uns von alten role models befreien und mehr Zeit und Energie in das Recruiting und den Aufbau neuer Stimmen und Gesichter entgegen dem professionellen Mainstream investieren. Das bedeutet Arbeit, denn diese Moderatoren werden uns nicht zulaufen, wir müssen sie suchen, ihnen helfen, ihre Ecken und Kanten zu schärfen, anstatt sie abzuschleifen, und Fehler zulassen, wenn sie auch manchmal wehtun, anstatt aus Angst vor ihnen alles zu reglementieren. Ein solcher Erneuerungsprozess hört nicht an der Studiotür auf. Will Radio ein Teil der Lebensrealität seines Publikums bleiben, dann müssen sich seine Redaktionen auch personell dieser öffnen. Unsere Gesellschaft verändert sich rapide, in unseren Redaktionen fehlt es aber an Menschen, die das repräsentieren. Hier brauchen wir mehr Vielfalt, Programmmacher aus allen kulturellen und sozialen Schichten, nur so können wir gemeinsam an einer zeitgemäßen Version von Radio arbeiten.
Freiraum für Neugier
Hat das Radio also noch eine Zukunft? Ich sehe zuerst einmal viele Fragen, denen wir uns stellen müssen. Denn eins ist klar, die jetzt noch üppigen Reichweitenpolster werden schmelzen und wir Radiomacher werden uns bewegen müssen - und das in mehrere Richtungen. Wir müssen die Bekanntheit unserer Marken ins Digitale überführen, Innovationen aus dem Radio heraus auf neuen Kanälen schaffen, konsequenter programmliche Brücken zwischen den Welten bauen, in unsere technische Verbreitung investieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren. Vor allem aber werden wir uns und unsere Arbeit noch einmal neu definieren müssen. Wenn wir glauben, dass wir in der fast hundertjährigen Geschichte des Radios schon alles bis ans Ende perfektioniert haben, dann liegen wir falsch. Hier wünsche ich mir mehr Mut und Entschlossenheit von Programmmachern und Programmverantwortlichen, mehr Freiraum für Neugier, Experiment und Scheitern und auch ein bisschen mehr Entspannung in diesen angespannten Zeiten. In Anbetracht der Aufgaben, die vor uns liegen, ist das wahrscheinlich die größte Herausforderung.
Es gibt zahlreiche Schauplätze, auf denen sich die Zukunft des Hörens abspielt. Ob das Radio bei all dem noch mitspielen wird, hängt davon ab, wie sehr es sich noch verändern kann - und vor allem will. Geht es um die Frage nach der Zukunft des Radios, wird es schnell existenziell. Ich kenne Kollegen, die mit scheinbar ungetrübtem Optimismus an die Zukunft des Radios glauben, ich kenne aber auch Kollegen, die gerade mit Blick auf fallende Reichweiten in der jungen Zielgruppe eher skeptisch nach vorne schauen. Und ich beobachte einen weiteren interessanten Reflex: Geht es um die Zukunft des Radios, wird gerne über alles geredet - außer über das Radio selbst.
Überraschung statt Format
Kluge Menschen reden sich auf Zukunfts- und Innovations-Panels die Köpfe heiß und sind sich am Ende doch einig: Wenn das Radio überleben will, dann muss es sich zur multimedialen Medienmarke entwickeln. Es geht um Digital- und um Diversifizierungs-Strategien, neue technische Verbreitungsmöglichkeiten, crossmediale Arbeitsweisen, immer kürzer werdende Innovationszyklen, Seeding und SEO und weitere Buzzwords der heutigen Medienwelt. Alles richtig und notwendig, nur zielt das am Kern der Frage vorbei. Ob wir in 10, 20 oder 30 Jahren noch Radio hören werden, entscheidet sich nicht nur daran, ob es dem Radio gelingt, sein Angebotsspektrum im Digitalen auszubauen, sondern auch daran, ob es ihm gelingt, sich selbst noch mal so weit zu verändern, dass es im vollen Medienportfolio der Menschen weiterhin relevant bleibt. Eine Chance des Radios liegt hier tatsächlich in seiner Linearität und in seinem Selbstverständnis, es muss gar nicht mehr um die totale Aufmerksamkeit seines Publikums buhlen. Als Radiomacher ist man genügsam, passt sich dem Alltag seines Hörers an und gestaltet sein Programm so, dass dieser parallel dazu sich die Zähne putzen, Autofahren, den Abwasch machen und auch ganz andere Medienangebote nutzen kann. Radio funktioniert wunderbar als Second Stream, als zuverlässiger Tagesbegleiter, als Kumpel, der einem das Gefühl gibt, dass bei allem, was da draußen passiert, die Welt sich weiterdreht.
Linearität schafft hier klare Verhältnisse, strukturiert, bietet Vertrauen und liefert gleichzeitig neue Impulse. Sie bietet dem Hörer eine Mischung aus Erwartbarem und Überraschung, die weder zu sehr stört, noch zu sehr langweilt - quasi das Rezept, nach dem auch Empfehlungs-Algorithmen im Netz die Inhalte für ihren User vorselektieren. Jede Musik-Playlist, jeder persönliche Facebook-Stream, jede Youtube-Empfehlung funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip: Sie möchte dem User so viel Neues anbieten, wie er verträgt, und so viel Gewohntes liefern, wie er für sein Wohlbefinden braucht. Leider hat das Ganze einen Haken. Wenn man zu sehr auf das Erwartbare, das Bequeme, das, was vermeintlich alle mögen, abzielt, wird es schnell langweilig. Im Netz heißt das Filterblase, im Radio spricht man von Format. Radio- und Musik-Consulter haben hier in den letzten 20 Jahren einen guten Job gemacht und uns haargenau erklärt, was der Hörer von uns will, wie er es will und in welcher Regelmäßigkeit. Sie haben die Überraschung zugunsten der Durchhörbarkeit aus vielen Programmen verbannt und dafür eine gleichförmige Radiolandschaft hinterlassen. Fragt man Menschen auf der Straße, was sie unter Radio verstehen, bestätigen sie genau das. Radio ist für die meisten penetrant gut gelaunte Morningshow-Moderatoren, der beste Wetter- und Verkehrsservice, endlich Feierabend mit den immer gleichen besten Hits von heute und gestern und dazwischen ein Hörer-Gewinnspiel zum Meet & Greet mit Ed Sheeran oder für das neue iPhone X. Radio ist für viele zu einem Klischee geworden, mit dem es sich zwar aushalten lässt, das sich aber immer weiter von dem entfernt, was das Medium eigentlich sein möchte: nah dran am Menschen und seiner Lebenswelt. Das müssen wir ändern.
Im Alltag der Hörer verankert.
Nähe, Lokalität und Emotionalität sind die drei großen Schlagworte, die Radiomacher gerne für ihr Medium beanspruchen. Und es stimmt, Radio ist immer dann besonders erfolgreich, wenn es ein Gefühl transportiert, eine kollektive Stimmung aufgreift und im Alltag seiner Hörer verankert ist. Gerade in einer global vernetzten Welt liegt die Stärke des Radios in seiner zeitlichen Unmittelbarkeit und seiner regionalen Verortung. Der australische Radio-Futurologe James Cridland beschreibt Radio als "eine geteilte Hörerfahrung mit einer menschlichen Verbindung". Wir müssen aufpassen, dass diese Verbindung nicht abreißt. Wenn Radio weiterhin ein Gemeinschaftsgefühl produzieren will, dann kann dieses nur in einem ehrlichen Dialog mit der Hörerschaft entstehen. Dafür müssen wir unsere Hörer ernst nehmen, sie nicht nur zu vorgecasteten Stichwortgebern und Jubel-Adjutanten degradieren, sondern auch unbequeme Stimmen im Programm zulassen. Genau das macht Radio authentisch. Und diese Authentizität gilt es von Generation zu Generation neu zu definieren. Wenn sich Mediennutzung, Kommunikation und Sprache verändern, sollten wir auch unsere alten Radiospielregeln überdenken. Gerade in einer so perfekt geölten Maschinerie wie dem Radio, wo jeder weiß, was, wann wie zu tun ist, ist das nicht einfach, aber bitter nötig.
Wir müssen "die Klassiker" unserer Zunft hinterfragen wie: Braucht ein Sender wirklich noch feste Claims? Wie sieht es mit der Bejingelung und dem Teasing unserer Inhalte aus? Was ist mit der Länge oder der Kürze unserer Wortbreaks? Und repräsentieren die Moderatoren und ihre Lebenswelt wirklich noch die Menschen, die wir ansprechen wollen? Authentische Moderatoren In der Branche wird gerne gejammert, uns würden heute die großen Moderatoren-Persönlichkeiten von früher fehlen. Wir machen es dem Nachwuchs aber auch nicht leicht, zu sehr haben wir ein vorgefertigtes Bild im Kopf von dem, was wir vermeintlich brauchen: Wir möchten souveräne On-Air-Personalities, die das Image unseres Senders transportieren, unsere Musik verkaufen und unsere Inhalte positionieren, gut drauf und immer politisch korrekt sind, fehlerfrei im engen Formatkorsett funktionieren und auf Knopfdruck hohe Quoten einfahren und dabei ganz selbstverständlich sie selbst und doch wieder austauschbar sind. Dieses Bild des perfekten Konsensmoderators hat sich leider auch im Kopf vieler angehender Moderatoren festgesetzt. Dagegen müssen wir anarbeiten, uns von alten role models befreien und mehr Zeit und Energie in das Recruiting und den Aufbau neuer Stimmen und Gesichter entgegen dem professionellen Mainstream investieren. Das bedeutet Arbeit, denn diese Moderatoren werden uns nicht zulaufen, wir müssen sie suchen, ihnen helfen, ihre Ecken und Kanten zu schärfen, anstatt sie abzuschleifen, und Fehler zulassen, wenn sie auch manchmal wehtun, anstatt aus Angst vor ihnen alles zu reglementieren. Ein solcher Erneuerungsprozess hört nicht an der Studiotür auf. Will Radio ein Teil der Lebensrealität seines Publikums bleiben, dann müssen sich seine Redaktionen auch personell dieser öffnen. Unsere Gesellschaft verändert sich rapide, in unseren Redaktionen fehlt es aber an Menschen, die das repräsentieren. Hier brauchen wir mehr Vielfalt, Programmmacher aus allen kulturellen und sozialen Schichten, nur so können wir gemeinsam an einer zeitgemäßen Version von Radio arbeiten.
Freiraum für Neugier
Hat das Radio also noch eine Zukunft? Ich sehe zuerst einmal viele Fragen, denen wir uns stellen müssen. Denn eins ist klar, die jetzt noch üppigen Reichweitenpolster werden schmelzen und wir Radiomacher werden uns bewegen müssen - und das in mehrere Richtungen. Wir müssen die Bekanntheit unserer Marken ins Digitale überführen, Innovationen aus dem Radio heraus auf neuen Kanälen schaffen, konsequenter programmliche Brücken zwischen den Welten bauen, in unsere technische Verbreitung investieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren. Vor allem aber werden wir uns und unsere Arbeit noch einmal neu definieren müssen. Wenn wir glauben, dass wir in der fast hundertjährigen Geschichte des Radios schon alles bis ans Ende perfektioniert haben, dann liegen wir falsch. Hier wünsche ich mir mehr Mut und Entschlossenheit von Programmmachern und Programmverantwortlichen, mehr Freiraum für Neugier, Experiment und Scheitern und auch ein bisschen mehr Entspannung in diesen angespannten Zeiten. In Anbetracht der Aufgaben, die vor uns liegen, ist das wahrscheinlich die größte Herausforderung.
Das Radio muss sich in mehrere Richtungen entwickeln
#3563 / O-Ton / mit Geodaten / Dokublog
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
