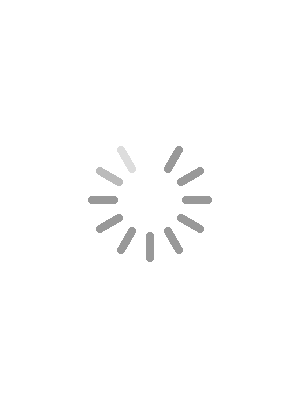
Intimradio: individuell gemeinsam hören.
16.09.2014
Vor einer Weile haben wir hier darüber gesprochen, wie man sich beim Radiohören verbunden fühlt, wie viele Hörer einer Sendung oder eines Senders eine „imagined community“, eine ausgedachte Gemeinschaft bilden. Vor Kurzem ist unser MOOC nun gestartet und unsere Community ist nicht mehr ausgedacht. Auf unserer Plattform tauschen sich Radioforscher, -freunde und -macher von überall auf der Welt aus – und sie haben kein Problem damit, unseren verstaubten wissenschaftlichen Konzepten zu widersprechen. Denn auch unserer Community haben wir das Konzept der imagined community vorgesetzt und gleich Kritik geerntet. Ob ein 30 Jahre altes Modell überhaupt noch geeignet sei? Wieso denn nicht, sagen wir. Newtons Schwerkrafttheorie ist nach wie vor ausgesprochen gültig, und — um beim Thema zu bleiben — Aristoteles’ Dramentheorie gilt nach wie vor als Mutter jeder Dramaturgie. Ob es nicht neuere Ansätze in der Forschung gibt, wie Medien Identitäten prägen? Ja, das ist wohl so, und tatsächlich erweisen sich top-down-Ansätze wie der hier diskutierte, die mit einer allgemeinen, fern von Realität entwickelten Theorie einzelne Beispiele im echten Leben beschreiben wollen, oft als irrig. Die einprägsamste Anmerkung zur imagined community kam aber nicht aus einer wissenschaftlichen, sondern aus einer ganz persönlichen Perspektive:
„Stellen sich Hörer andere Hörer vor, während sie Radio hören?“ schreibt da eine Teilnehmerin, „Ich muss für mich selbst sagen: Nein, mache ich nicht. Und meistens fühle ich mich auch nicht als Teil einer zuhörenden Masse, sondern als persönlicher Freund des Moderators. Es fühlt sich an, als ob er oder sie mit mir spricht, direkt mit mir. Das ist es, was ich besonders am Radio mag. Es spricht mit dir. Es ist die Stimme und das Gefühl von jemandem, der mit dir spricht und dir etwas erzählt. Ganz persönlich.“
Dem Einwand wird stattgegeben, also teilweise. Ist nicht trotzdem etwas dran an der Idee, dass uns das Radio, vermutlich meist unmerklich, in eine große Gemeinschaft einbindet? Auch wenn wir beim Zuhören nicht permanent das Bild der anderen Hörer im Kopf haben, kommt es doch irgendwie dahin – wie bei diesem MOOC-Teilnehmer:
„Zum Beispiel 99% Invisible: Am Ende dankt der Moderator denen, die etwas zur letzten [Finanzierungs]Kampagne beigesteuert haben. Er sagt nicht nur ‚danke‘, sondern sagt, dass die Hörer die Show unterstützen. Er nennt die Hörer nicht nur ‚Hörer‘, sondern ‚besonders geistreich, wunderschön, geschmackvoll‘ und so weiter. Und wenigstens bei mir klappt das: Ich würde mehr von einem Fremden halten, wenn er mir am Anfang eines Gesprächs erzählt, dass er oder sie 99 % Invisible hört (und sogar noch mehr, wenn er oder sie ein bisschen Geld gespendet hat). Ich weiß, dass das vielleicht merkwürdig und sogar ein bisschen oberflächlich ist, aber ich kann nichts dagegen machen.“
Auch wenn wir beim Hören vor allem damit beschäftigt sind, dem Moderator an den Lippen zu hängen, entsteht das Bild von den anderen in uns – meist unbewusst. Und wahrscheinlich ist das Zen des Hörens nicht unschuldig daran, dass die imagined community nicht mit dem Holzhammer, sondern subtiler in unser Unterbewusstsein gerät.
Denn Radiohören, richtig Zuhören, ist eine besondere Erfahrung. Die persönliche Bindung, das gerade nicht Einsame, sondern Zweisame am Radiohören, ist vermutlich auf den ersten Blick stärker als die Gemeinschaft der Hörer.
Radiohören kann ein meditatives, parasoziales Erlebnis sein, ein Einswerden mit dem Moderator, ein Eintauchen in die Stimmung des Hörspiels oder eine körperliche Verbindung mit dem Rhythmus und Sound der Musik. Gerade deswegen ist uns vielleicht nicht immer bewusst, was es in uns auslöst. Zumindest in einzelnen Momenten evoziert Radio, diese Vorstellung von räumlicher Ausdehnung, die eine Stadt oder ein Land hat; von einer ‘typischen’ Mentalität, die wir irgendwo abgespeichert haben; von Zusammenhalt aufgrund einer gemeinsamen Geschichte, eines gemeinsamen Schicksals, gemeinsamer Interessen. Die Bildung solcher imagined communities ist vielleicht nicht die augenscheinlichste Wirkung von Radio, aber trotzdem eine überaus wichtige.
Wie Radio in diesem Sinne ‘wirkt’, hängt natürlich auch davon ab, wie man hört — bzw. ob man ‘zu-hört’. Fast alle (Deutschen) hören Radio, aber hört jemand dem Radio auch zu? Lange als Nebenbei-Medium (englisch „secondary medium“) fürs Autofahren abgestempelt, scheint das Radio gerade in der Nische der Podcasts Aufwind zu bekommen. Durch intensivere Hörerforschung wird so langsam sichtbar, wieviele Leute nicht nur die besten Hits von vorgestern zur musikalischen Untermalung ihres Alltags wollen, sondern viel lieber wirklich zuhören. Zum Beispiel stellte Ekkehard Oehmichen mit seiner Abteilung Medienforschung des hessischen Rundfunks fest, dass die Akzeptanz von Kultur- und Inforadios im Netz recht stabil geblieben sei. Gerade die anspruchsvolleren Angebote seien demnach besonders gefragt.
Trotzdem geben Zahlen aus der Hörerforschung nur Aufschluss darüber, wie viele Leute wann Radio hören, aber nicht so sehr darüber, wer sie sind und wie sie zuhören – mal abgesehen davon, ob sie denn überhaupt hinhören. Diese Detailfragen haben aber Radiomacher nicht davon abgehalten, sich ein eigenes Bild ihres Publikums auszudenken. Vor allem in Programmzeitschriften der Kulturwellen wird das Ideal des aufmerksamen, ungestörten Zuhörens seit langer Zeit in Bildern ausgedrückt: Zunächst vor dem noch schrankgroßen Radioapparat sitzend, später mit Kopfhörern, die Augen geschlossen, heute in Claims wie “die kunst zu hören” des rbb-Kulturradios. Der Hamburger Medienforscher Frank Schätzlein hat untersucht, wie sich öffentlich-rechtliche Hörspielredaktionen ihr Publikum vorstellen:
„Wenn die Sendung läuft, gilt dem Hörspiel seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Er ist voll konzentriert. Er sitzt lange Zeit entspannt, still und aufmerksam – wie er es aus dem Theater, dem Programmkino, der Oper oder dem Konzert mit Symphonieorchester, Kammermusikensemble oder Solisten gewohnt ist. Er würde nicht auf den Gedanken kommen, sich während der Sendung längere Zeit zu unterhalten, nebenbei in der Zeitung zu lesen oder zu kochen und dabei mit den Küchenuntensilien zu klappern.“
(Schätzlein, Frank 2011. »Der aufmerksame Hörer« Zur Diskursgeschichte des Hörspiels. In: Hörspielsommer e.V.[Hg.]. Hörspiel Plätze: Positionen zur Radiokunst. Voland & Quist Verlag. S. 89 f.)
Nicht zuletzt die Möglichkeit, Sendungen – wie es im besten Akademiker-Deutsch heißt – zum „zeitsouveränen Nachhören“ als Podcast irgendwann zu hören, reißt diese Traumvorstellung aber zurück in die harsche Realität. Auf Ohrstöpseln auf dem Arbeitsweg, im Zweikampf mit der Motivationsmusik des Sportstudios oder in Konkurrenz mit dem Wirrwarr aus Hörbuch, Legoattacke und Rollenspiel derKinder, die am Sonntagmittag nicht still vor dem Radio sitzen wollen … die Hörsituationen sind auch bei Kultursendungen längst nicht immer so fokussiert, wie die Macher sich das vielleicht wünschen. Das sollte Radioleute umso mehr dazu bringen, sich Gedanken zu machen, nicht nur wer am anderen Ende des Gerätes sitzt, sondern wie er sitzt, ob er überhaupt sitzt und wenn ja wielange. Statt den eigenen Idealhörer immer wieder ungefragt vorauszusetzen und die Radioprodukte für solch monolithisches Hören herzustellen, sollten die Möglichkeiten, die eigene Community, die eigene (Zu)Hörerschaft anzusprechen, genutzt werden.
Es könnte aber sein, dass das ‚klassisch‘ ausgebildeten Radioleuten gar nicht so leicht fällt. Denn, wie die MOOC-Teilnehmerin von weiter oben es schildert, haben die Radioleute gelernt: „Spricht nicht mit der Menge. Sag nicht mehr ‚meine Damen und Herren‘ – das ist veraltet.“ Radio soll eher einem Gespräch ähneln, bei dem nur eine Person spricht und eine zuhört — oder einfach nur hört? Das Simulieren eines Dialogs scheint naheliegend in einer Zeit, in der soziale Medien den Austausch auf Augenhöhe versprechen und das einseitige Verlautbaren ohne Rückkanal altbacken wirkt. So gesehen löst ein überhöhtes Ideal das andere ab: Der konzentrierte, nicht abgelenkte Hörspielgourmet von gestern wird zum aktiven Social-Kommentierer von heute. Und der Rest ist schweigende Masse?
In ihrem Buch Listening Publics argumentiert die Kulturwissenschaftlerin Kate Lacey gegen diese verengte Sichtweise: Das Zuhören ist eine bewusste Entscheidung, auch wenn man nicht die ganze Zeit stillsitzt oder die Sendung ausführlich bei Facebook kommentiert. Im Zeitalter der Massenmedien sind Öffentlichkeiten per Definition unpersönlich und grenzenlos. Ich bin auch dann ein Teil davon, wenn ich nur zuhöre – egal ob mit fünf Unterbrechungen auf dem Arbeitsweg, beim Kochen … oder dann doch mal ungestört im Sofasessel.
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
