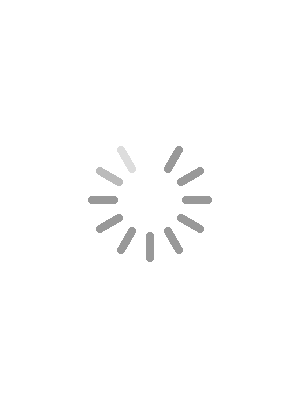
Wenn die community nicht mehr imagined bleibt
19.08.2014
Wer bin ich? Wer sind wir? Steht das nicht auf unserer About-Seite? Wir sind Radioforscher, wir sind Hallenser der einen oder anderen Sorte, wir sind in Deutschland geboren. So viel zu den Basics. Darüber hinaus wird es unklarer. Wir haben unterschiedliche Geschlechter, sind in unterschiedlichen Regionen dieses Landes geboren, in unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen.
Wer wir sind, das entscheiden wir nicht allein: Unsere Identität wird bewusst und unbewusst von außen beeinflusst.
Ein schlauer Ansatz, um vielleicht die Frage „Wer bist du?“ zu beantworten, stammt aus dem Jahr 1983, vom Politikwissenschaftler Benedict Anderson. Er definiert Identität als die Vorstellung von Zugehörigkeit zu imagined communities, ausgedachten Gemeinschaften. Echte Gemeinschaften, so Anderson, gibt es nicht – wenn man mal solche ausklammert, bei denen man alle Mitglieder kennt und persönlich treffen kann, kleine Dörfer, die nahe Familie. Alle anderen - Städte, Regionen, Nationen, politische Gruppierungen, Fußballfanclubs - sind Gemeinschaften, in denen sich die meisten Mitglieder nicht kennen, sich nie treffen, nichts voneinander hören. Und doch gibt es in der Vorstellung jedes Mitglieds ein Bild von der Gemeinschaft. Doch wie kommt diese Empfindung da hin, wenn sich die Mitglieder noch nie gesehen haben? Anderson behauptet: Durch die Massenmedien. Er erklärt die Bildung von Nationen durch das Aufkommen des Buchdruck-Kapitalismus (print capitalism) im 16. Jahrhundert. Nationalstaaten - so Anderson - konnten überhaupt nur enstehen, weil die Grundlage für die Identitätsbildung der Menschen verändert wurde. Im Mittelalter sei es besonders die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft gewesen. Sie habe den Menschen Halt gegeben, Geschichte, Wahrnehmung und Gesellschaft strukturiert. Doch der Buchdruck habe das verändert. Um sich neue Märkte zu erschließen, haben Buchdrucker nicht mehr nur lateinische, sondern Bücher in den Muttersprachen der Menschen veröffentlicht und damit zur Vereinheitlichung der Sprachen beigetragen. Ganz nebenbei haben sich an diesen neuen, sprachlich einheitlichen Märkten Nationen herausgebildet – mit Bürgern, die sich einander verbunden fühlen, die eine gemeinsame Geschichte und vermeitlich gemeinsame Ziele haben. Denn wer ein Buch liest, der weiß, dass es andere Menschen gibt, die das gleiche lesen, das gleiche denken, auch wenn er sie nicht kennt und niemals treffen wird. In ihrer Unsichtbarkeit werden Sie für den Mediennutzer trotzdem füreinander sichtbar, eine „imagined community“..
imagined community – ein Modell für die Radioforschung?
Spannender wird dieses Modell, wenn die Medienentwicklung über Printmedien hinaus geht. Für Radioforscher ist das Konzept der imagined community Handwerkszeug, um zu verstehen, wie Radiohören und Identität zusammenhängen. Im Gegensatz zu den Lesern von Büchern und Zeitungen hört ein Radiopublikum eine Sendung sogar gleichzeitig, das Radio verbindet so Menschen an verschiedenen Orten, mit verschiedenen sozialen Hintergründen zu einer community. Das kann zufällig passieren, weil viele Menschen Freude an einer Sendung oder einem Sender haben und sich den gleichen Dingen verbunden fühlen – oder ist kalkuliert: Michelle Hilmes zeigt, dass Radio in den 1920er-Jahren als „the nation’s voice“ die Amerikanisierung Amerikas, also eine Vereinheitlichung der Kultur bewirken sollte, um das kulturell und ethnisch diverse Land gesellschaftlich zu stabilisieren. Jeder Einwanderer sollte potentiell jederzeit vor Ohren haben, wie man sich verhält, wie man klingt, wie man sich amüsiert und welche Bildung man besitzt, wenn man ein originäres Mitglied der amerikanischen Gemeinschaft ist.
Radio-Vermarkter versuchen, die komplexen Wertesysteme und kulturellen Codes, die hinter einem solchen Unterfangen stehen, ‘kondensiert’, quasi als ‘Essenz’ oder ‘Konzentrat’ in die hörbare Identität von Radiosendern zu übertragen. Jeder Radiohörer kennt das gebetsmühlenartige Wiederholen von Station IDs (Senderkennung), Claims („nur die beste Musik der …“) und eines bestimmten Tonfalls der Moderatoren, die Hörerbindung und gute Zahlen in Reichweitenberechnungen bescheren sollen – und zwar, wie im Beispiel des amerikanischen melting pot, durch das Schaffen eines Zugehörigkeitsgefühls zu einer imagined community.
Der Radioberater Eric G. Norberg geht z.B. so weit zu sagen, dass Radio derart hintergründig und sekundär wirkt, dass von ihm nurmehr Textur erwartet wird: „to provide a ‘texture’ or background accompaniment to mentally demanding tasks“. Hörer seien demnach dankbar, wenn sich Radio möglichst schlicht und gleichförmig präsentiert. Entsprechend rät er Radiosendern bei mangelndem Hörererfolg zu einer stärker erwartbaren Programmstruktur (z.B. Werbung regelmäßig alle 10 Minuten) und noch häufigerer Wiederholung der aktuellen Hits. Wenn er proklamiert, „the essence of programming is establishing—and then fulfilling—listener expectations“, dann beschreibt er eine imagined community: eine Gemeinschaft, die sich darin einig ist, dass ein bestimmter Sound ihr Leben untermauern und verbinden soll. Glücklicherweise gibt es auch noch ein paar Menschen, die Erwartbarkeit von Medieninhalten nicht als Maß aller Dinge ansehen.
Die „imagined community“ wird sichtbar: Erste MOOC-Eindrücke
Die imagined community im Hinterkopf und als Radiomacher gewohnt, dass wir ein meist unsichtbares Publikum ansprechen, hier ein paar Beobachtungen, was ein MOOC wie der, den wir demnächst starten, mit dem Bild macht, das wir von unserer community haben.
In unserem Werbevideo sagen wir ganz casual „connect with radio people from all over the world“, wir sagen, dass wir einen Kurs über Transnationalität machen, dass wir uns wohlfühlen als Lehrende und Lernende im Internet, und das hoffen wir auch aufrichtig. Wir hatten auch schon ein Bild von unseren Kursteilnehmern: Es sind Radiointeressierte und Hör-Maniacs, Autoren und Medienschaffende, die von Storytelling fasziniert sind; es sind Geistes- und Kulturwissenschaftler, die sich mit Interkulturalität befassen. Sie kommen von überall auf der Welt, sie haben akademisches und/oder praktisches Interesse an Radio, an Geschichten und an der Komplexität von Kulturen.
Und doch haut es uns ein wenig aus den Socken, was passiert, wenn diese imagined community, zu der wir uns auch selbst zählen, auf einmal sichtbar wird. In vielen Mails von Interessenten wird auf unerwartete Weise deutlich, welche Gesichter und Menschen hinter denen stecken, die wir uns bis jetzt nur vorgestellt haben:
Eine amerikanische Professorin, die in Südkorea Vorlesungen über indisches Yoga hält. Ein englischer Hochschullehrer für Radioproduktion. Ein Schotte, der in seiner Freizeit bei einer Community Radio Station arbeitet, aber im Day Job einen MOOC über Forensik erstellt, komplett mit Beispielmordfall. Eine italienisch-schweizerische (Audio-)Poetin. Eine Filipina, die in Schweden über Transnationales Radio promoviert. Eine Radioforscherin von der christlichen Universität in Canterbury.
Wir wussten, was uns erwartet, wer theoretisch zu unseren Teilnehmern gehören könnte doch dass die, die sonst „imagined“ bleiben, auf einmal durch Feedbackkanäle wie E-Mail ein Gesicht bekommen, fühlt sich komisch an. Viele Leute, die wir noch nie persönlich getroffen haben, die wir wahrscheinlich höchstens mal in einem Videochat, (wenn überhaupt) sehen werden, haben Interesse an den gleichen Dingen, die wir interessant finden, wollen sich mit uns austauschen.
Überwindet das Internet nationalstaatliche Identitätskonstruktion?
Anderson entwickelte seine Theorie von der „imagined community“ im Kontext von Nationalstaaten, und wie jede gute Theorie wurde sie erweitert und in neue Kontexte gesetzt – von den gezielten Lenkungsstrategien der „nation’s voice“ bis zur Vermarktung des sogenannten Dudelfunks. Angesichts der vielfältigen Hintergründe unserer stetig wachsenden MOOC-Gemeinschaft stellt sich aber die Frage: Ist Nationalität in Zeiten globaler Vernetzung überhaupt noch ein Maßstab für Identitätsbildung – und wie sehr ist eine global jederzeit nachles- und kontaktierbare Community noch vorgestellt?
Ein Schlussgedanke, um unseren MOOC nicht zu sehr zu spoilern: Für neue Medien gibt es die Theorie, dass bestehende Medien nicht komplett verdrängt werden, sondern – mit kleinerem Nutzerkreis und bei neuer Ausrichtung – ergänzend bestehen bleiben. Schafft also das Internet neue Möglichkeiten, über die Nation hinaus vielschichtige Identität(en) auszubilden? Unsere Sprache, Stadt, Region und das Land, in dem wir leben, werden auch weiterhin viele Aspekte unserer kulturellen Identität prägen. Wenn ich mich aber über das Netz mit anderen Fans meiner Lieblingspodcasts austauschen kann, statt auf das Hörertelefon des lokalen Dudelfunks angewiesen zu sein, wird ein Teil meiner Identität abseits nationaler Grenzen geprägt. In diesem Moment sind „Transnational Radio Stories“ dann plötzlich sehr greifbar.
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
