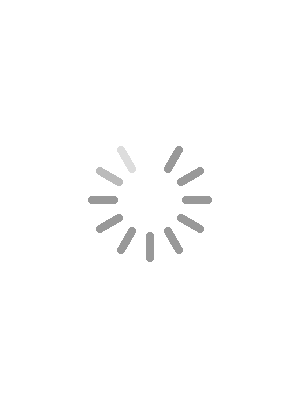
Angela Keppler
Radio als Medium beiläufiger Kommunikation

Das Radio als Medium beiläufiger Kommunikation Das kleine, ‚beiläufige’ Gespräch nebenbei – sei es beim Einkaufen mit der Verkäuferin, die man schon lange, aber eben nur von solchen Gelegenheiten her kennt, die kurze Plauderei, wenn man einem netten Kollegen auf dem Campus zufällig begegnet, die Unterhaltungen, die man mit einem ansonsten unbekannten Personen beim Spazierengehen mit dem Hund im Wald oder sonst wo führt, die Gespräche beim Zugfahren, oder beim gemeinsamen Warten auf einen verspäteten Flug – sie alle sind auch in den heutigen mediatisierten Zeiten – entgegen zahlreicher Unkenrufe – nicht ausgestorben. Und sie haben auch heute noch eine zentrale gemeinschaftsstiftende Funktion. Es handelt sich dabei, wie es der Soziologe Georg Simmel schon vor knapp hundert Jahren formuliert hat, um eine "Spielform der Vergesellschaftung". Was hat das nun mit dem Radio zu tun? Das Radio, das in der einschlägigen Forschung gerne als ein „Nebenbeimedium“ beschrieben wird, ist aus meiner Sicht nicht nur die mediale Variante dieser Form der Kommunikation, sondern darüber hinaus ein lebendiger Ausdruck der Relevanz dieser Kommunikationsform auch und gerade unter den heutigen Bedingungen der Medienkonvergenz. Das Radio, das durch Computer und mobile Endgeräten mittlerweile eine neue Präsenz erhalten hat, ist für nicht wenige von uns ein nach wie vor allgegenwärtiger, wenn auch oft unauffälliger Begleiter unseres Alltags. Diese Beiläufigkeit ist aber gerade der Witz an der Sache. Das Radio versorgt uns ständig mit mehr oder weniger wissenswerten, geistreichen, ablenkenden oder animierenden Informationen. Aus der Perspektive der Rezipienten bleibt es hier weitgehend dem Zufall überlassen, mit was für Beiträgen sie jeweils unterhalten werden. Deren Selektion, ist zwar durch die jeweiligen Programme vorgegeben, die Hörerinnen und Hörer aber wissen bei der Anwahl eines Senders trotzdem nicht, was ihnen im Einzelnen dort begegnen wird. Außer2 dem kann sich das Publikum durch die Art der Aufmerksamkeit und den Wechsel der Sender seinerseits höchst selektiv verhalten, ähnlich wie man sich bei einer Party nach Belieben von der einen zur anderen Gesprächsgruppe bewegen kann. Wenn ich beispielsweise beim Autofahren auf dem Weg an die Uni im Radio mitbekomme, dass Facebook gerade Whats App gekauft hat, dass wieder mal ein Minister zurückgetreten ist oder wie die Lage in der Ukraine sich entwickelt, so liefert mir das Stoff für Gespräche, gegebenenfalls sogar im Seminar, mit dem ich zuvor nicht rechnen konnte. Das Radio ist ein fast stets ergiebiger Themenlieferant, woran wir in weiteren Kommunikationen je nach Bedarf und Belieben anschließen können. Entgegen anderslautender Gerüchte ist dabei das Radio, wie auch die neueren und neuesten Kommunikationsmedien kein Gesprächsverhinderer, sondern eine alles in allem unverdächtige Quelle der kommunikativen Gemeinschaftsbildung. Bei diesem Lob der beiläufigen Inspiration durch das Radio aber dürfen wir eins nicht vergessen: Radiohören heißt fast immer auch Musik zu hören – und zwar eine Musik, die wir uns nicht vorher selbst zusammengestellt haben und dann auf diversen Abspielgeräten serviert bekommen. Das Radio kann unsere Empfänglichkeit für Musik auf besondere Weise überraschen und überrumpeln, weil hier nicht selten starke Titel gespielt werden, die nicht zu unserem auf Smartphones und anderswo gespeicherten Standardrepertoire gehören. Plötzlich, ohne darauf vorbereitet zu sein, bekommen wir einen Rocksong oder eine Bachkantate zu hören, die uns lange nicht mehr in den Sinn gekommen ist. Auf einmal sind wir hin und weg. Wir sind es, weil diese Musik mit einem biografischen Schlüsselerlebnis verbunden ist oder uns einfach durch ihre Energie in einen anderen Zustand versetzt. Manchmal kommt beides zusammen. Wenn ich irgendwo mit dem Auto unterwegs bin und im Radio unverhofft Riders on the Storm von den Doors, gesungen von Jim Morrison, zu hören ist, fühle ich mich augenblicklich in die kalifornische Mojave-Wüste versetzt, auf deren Highways mich dieser Song vor vielen Jahren begleitet hat.
Angela Keppler
#2470 / O-Ton / mit Geodaten / Dokublog
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
