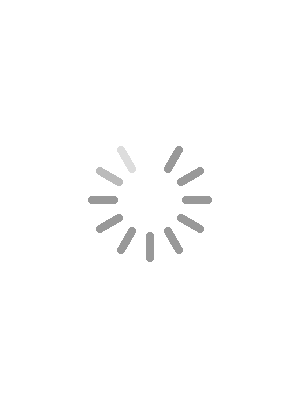
"Eine Leitidee für den Rundfunk"
Hermann Rotermund

von Hermann Rotermund
Eine neue Leitidee für den Rundfunk
Wer gehofft hatte, in diesem Sommer eine medienpolitische Wende zu erleben, sieht sich getäuscht. Es liegen keine neuen Konzepte auf dem Tisch, die dem heutigen Rundfunk eine Zukunft im Netz der Netze bahnen. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die eigens zu Strukturüberlegungen aufgefordert wurden, die über organisatorische Optimierungen hinausgehen, verweigern den Zukunftsdiskurs und legen ihr Schicksal in die Hände von Medienpolitikern und Lobbyisten. Untote Begriffe geistern durch die Papiere: die Presseähnlichkeit und der Sendungsbezug. Mittlerweile ist die Entwicklungsdynamik der digitalen Medienumgebungen, in denen Presse und Sendungen keine Rolle mehr spielen, ungebrochen. Die öffentlichen Rundfunkunternehmen jedoch graben sich ein und hoffen offenbar, ihren Besitzstand so am besten verteidigen zu können.
I Zukunftsfähige Veränderungen des Rundfunksystems müssen an seinem Zentrum ansetzen, am rundfunkrechtlichen Programmauftrag. Alles andere – Organisation, Kooperationen, Verwertungsstrategien – ist demgegenüber zweitrangig. Der bestehende Programmauftrag ist in der deutschen Rundfunkgeschichte verankert und in Begriffe gefasst, die ebenso hinterfragt werden müssen wie die Ziele des Auftrags. Die Schlüsselbegriffe des Rundfunkrechts sind zwischen 1961 und 1994 eingeführt worden, der Blütezeit der Massenmedien. Für die Welt der Massenmedien und ihre spezielle Konfiguration in Deutschland lieferten sie auch zeitgemäße Orientierungen. Wie können aber unter den heutigen, durch Netzwerkmedien bestimmten Kommunikationsverhältnissen „Vielfalt“ und „Integration“ noch produktiv gemacht werden?
Zur veralteten Begriffswelt rechtlicher Medienbeschreibungen gehört die Präambel des Rundfunkstaatsvertrags, worauf die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, mehrfach hingewiesen hat. Dort finden sich noch Anklänge an eine Medienlandschaft, in der es außer der Presse nur das unter Frequenzknappheit leidende duale Rundfunksystem gab. Andererseits gibt die Präambel einen Hinweis, der als Anstoß zur Innovation verstanden werden kann.
Beide Rundfunksysteme – das öffentlich-rechtliche und das private, so heißt es da – „müssen in der Lage sein, den Anforderungen des nationalen und des internationalen Wettbewerbs zu entsprechen“. Nun setzen gerade internationale Wettbewerber wie Netflix, Spotify und Amazon beide deutschen Rundfunksysteme unter Druck, und diese versuchen, mit neuen Konzepten auf die Wanderungsbewegung des Publikums zu reagieren. Für viele Studierende ist beispielsweise ein Netflix-Abo selbstverständlich, nicht aber ein eigenes Fernsehgerät. Ob mit dem Ausbau bestehender Mediatheken oder der Gründung neuer übergreifender Plattformen etwas erreicht werden kann, hängt auch davon ab, ob deutsche Rundfunkanbieter online erfolgversprechende Handlungsmöglichkeiten haben. Diese sind zumindest den öffentlich-rechtlichen Anstalten verwehrt. Der Rundfunkauftrag bezieht sich primär auf lineare Sendungen. Programm wird im §2 des Rundfunkstaatsvertrags als „eine nach einem Sendeplan zeitlich geordnete Folge von Inhalten“ beschrieben.
Unter diesen Bedingungen bleiben Online-Angebote grundsätzlich ein Annex des linearen Programms – mit einer Ausnahme, dem speziell beauftragten Jugendangebot FUNK. Die aktuellen Mediatheken der Sender enthalten Sendungen oder Sendungsfragmente, die für die lineare Verbreitung produziert wurden. Sie sind keine eigenständige Programminstanz und dürfen das auch gar nicht sein. Es wäre jedoch Zeit für einen rechtlichen und faktischen Perspektiv- und Paradigmawechsel. Wenn der Programmbegriff aus der Linearität entlassen wird, „Programm“ also alles das sein darf, was im Rahmen des gesetzlichen Auftrags produziert wird, ist die Gründung von Programmdirektionen bzw. Gemeinschaftseinrichtungen für Mediatheken und Audiotheken der nächste konsequente Schritt. Diese müssen dann finanziell so ausgestattet werden, wie es der absehbaren Bedeutung dieser Einrichtungen für das Publikum entspricht. Die Aufgabe der Mediatheken wäre nicht nur die Zweitverwertung von „Sendungen“, sondern auch die Eigenproduktion von Beiträgen und „Kanälen“ – und darüber hinaus die intensive Interaktion mit den Nutzern.
II Den Verfassungsjuristen ist es im Laufe der Jahrzehnte seit dem ersten Rundfunkurteil 1961 gelungen, aus einem einzigen Satz des Grundgesetz-Artikels 5 – Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet – eine umfangreiche Definition von Rundfunkaufgaben abzuleiten. Darunter fallen ein Grundversorgungs- und Funktionsauftrag, Leistungen zur Förderung der gesellschaftlichen Integration, Beiträge zur Sichtbarmachtung vielfältiger Meinungen und die Bestimmung des Verhältnisses von öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Rundfunkmedien – um nur einige zu nennen. Dabei wurde auch mehrfach die Rechtsform bestätigt, die der Rundfunk ursprünglich durch das britische Besatzungsregime erhielt. Sie wurde allerdings vom Bundesverfassungsgericht als jederzeit durch ein anderes Modell ablösbar bezeichnet. Die jetzigen Anstalten müssen den Widerspruch ausbalancieren, „Aufgaben der öffentlichen Verwaltung“ wahrnehmen zu sollen (wie es im 2. Rundfunkurteil von 1971 heißt) und andererseits das Gebot der Staatsferne umzusetzen, das zuletzt im ZDF-Urteil des Verfassungsgericht von 2014 bestätigt wurde.
Der ebenfalls 1971 formulierte Auftrag, eine „integrierende Funktion für das Staatsganze“ zu erfüllen, zielt auf die Mitwirkung des Rundfunks an der Erhaltung der staatlichen Gewaltenteilung. Die erwünschten Leistungen eines unparteilichen, „binnenplural“ verfassten Massenmediums werden dabei modellhaft mit der Vorstellung einer aus Institutionen (und nicht aus Individuen) kombinierten Gesellschaft zusammengeschaltet. Offenkundig hat dieses Modell den Bezug zu den aktuellen gesellschaftlichen Konstellationen eingebüßt. Jene Institutionen, deren Vertreter in plural zusammengesetzten Gremien die Aufsicht über die öffentlich-rechtlichen Anstalten führen sollen, verlieren rapide an Bedeutung. Die Zahl der Mitglieder von Gewerkschaften und Parteien hat sich seit 1990 halbiert, Kirchen spielen keine Rolle mehr bei der Meinungsbildung in gesellschaftlichen Fragen, und früher einflussreiche Periodika dieser Organisationen sind verschwunden. Neue Akteure der Meinungsbildung sind jetzt „zivilgesellschaftliche“ Gruppierungen. Netzpolitische Aktivisten und Pulse of Europe, Pegida und die Unterzeichner der „Gemeinsamen Erklärung 2018“ machen Angebote für identitäre Bestrebungen, bilden dabei aber keine Institutionen, die zeitlich und organisatorisch so stabil sind wie die vorgenannten. Wenn durch die etablierte binnenplurale Aufsichtsform nur noch eine Minderheit der Gesellschaft repräsentiert wird, stellt sich unter anderem die Frage, ob durch sie die innere Pressefreiheit in diesen Unternehmen noch garantiert werden kann. Die Fiktion der institutionalisierten Öffentlichkeit, die den Integrationsauftrag gespeist hat, kann in einer vernetzten und zunehmend ent-institutionalisierten Gesellschaft kaum noch aufrechterhalten werden. Eine Leitidee, die auf den Nutzen der Medien für die Gesellschaft statt auf den Nutzen für das „Staatsganze“ ausgerichtet ist, wäre der neuen Lage viel angemessener.
III Ein angesichts der sich entwickelnden digitalen Medienkultur zunehmendes Problem des deutschen Rundfunkauftrags ist der hohe Ton seiner Ansprüche. Der Rundfunk soll „Faktor“ und „Medium“ der Meinungsbildung sein und wird geradezu als demokratiekonstituierend dargestellt, da eine durch ihn ermöglichte vielfältige „öffentliche Meinung“ entscheidend sei für eine demokratische Willensbildung. Insofern erfülle der Rundfunk eine „öffentliche Aufgabe“. Welchen Dienst er der Gesellschaft leisten kann, welche Wünsche und Bedürfnisse der von ihm adressierten Kommunikationsgemeinschaft er erfüllt und welchen Wert er auch deshalb für die Gesellschaft bereitstellt, kommt in diesen psalmodierenden Beschreibungen nicht vor.
In den letzten beiden Jahrzehnten fällt auch in deutschen Fachdiskussionen häufig der Begriff Public Value. Er geht unter anderem auf Arbeiten des amerikanischen Politik- und Wirtschaftswissenschaftlers Mark Harrison Moore zurück. Dieser fragte, welche Werte der Gesellschaft und ihren Mitgliedern entgehen, wenn öffentliche Aufgaben (Bibliotheken, Wasserversorgung, öffentliche Sicherheit etc.) privatisiert und unter das Regime betriebswirtschaftlicher Kalkulationen gestellt werden. Die Erfüllung der erwähnten „öffentlichen Aufgabe“ im Bereich der Willensbildung könnte als deutsche Variante des Public Value interpretiert werden. In Frankreich würde sicher der kulturelle Wert fokussiert (z. B. im Hinblick auf die französische Filmproduktion), in Großbritannien eher der wirtschaftliche Nutzen, den die Medienbranchen durch gemeinschaftlich finanzierte Medien erfahren. Moore hob zusätzlich einen Aspekt des Public-Value-Begriffs hervor, seine Plastizität, die sich aus der jederzeit notwendigen neuen Aushandlung seiner Bedeutung herleitet. Um die Tauglichkeit des Public-Value-Konzepts zur Neubestimmung eines Leitbegriffs für gesellschaftlich gestützte Medien zu erproben, wären nach Moores Muster die Verluste abzuschätzen, die eine Gesellschaft beim Wegfall dieser Medien erführe. Eben diese Fragestellung mobilisierte das Wahlvolk in der Schweiz vor der NoBillag-Abstimmung, die mit einer über 70-prozentigen Bestätigung der gemeinschaftlichen Finanzierung endete.
Moores Evaluierungsvorschlag für den Public Value von Unternehmen zielt auf die Kombination von drei Verfahren: Die Ermittlung der Zufriedenheit der aufsichtsführenden Körperschaft mit der Leistung des Unternehmens, die Bewertung der Ergebnisse durch das Management z. B. mithilfe von Kosten-Nutzen-Analysen und die Messung der Zufriedenheit von Kunden und Nutzern. Dem entspricht das von Moore ins Spiel gebrachte Dreieck von Legitimation, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz, in dem sich Public Value zu bewähren hat.
Eine Nutzenbestimmung nach einem breit angelegten Public-Value-Konzept, das nicht aus der Perspektive staatlicher Reproduktionsbedürfnisse gedacht ist, könnte nach vorn weisen. Dieser Gedanke wird auch in einer 500 Seiten starken Doktorarbeit im europäischen Vergleich untersucht. Die Autorin Christiana Gransow stellt für Deutschland fest, dass der Begriff aufgrund verschiedener terminologischer Bedenken nicht in das Rundfunkrecht aufgenommen wurde. Stattdessen wurde in den Dreistufentestverfahren der äußerst vage „qualitative Beitrag zum publizistischen Wettbewerb“ eingeführt. Für öffentlich-rechtliche Telemedienangebote ist der Nachweis zu erbringen, dass sie „den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen“. Im tatsächlichen Umgang mit dieser Anforderung beschränken sich die Sender und ihre Aufsichtsgremien allerdings auf die Verabschiedung selbsterstellter Inhaltsanalysen von Programmkategorien. Diese sagen jedoch kaum etwas darüber aus, welchen Wert das Programm für die Gesellschaft besitzt. So schwierig die von Moore vorgeschlagene Messung der Zufriedenheit der Mediennutzer methodisch auch ist, sie besäße doch einen höheren Auskunftswert als Selbstbeschreibungen und Absichtserklärungen der Unternehmen. Auch durch die Ermittlung der Meinungsbilder von Rundfunkräten lassen sich methodisch durchdachte qualitative und quantitative Nutzerstudien sicher nicht ersetzen. Derzeit bleibt zwischen dem Benchmarking der Anbieter und dem Wertempfinden des Publikums ein noch durch keine Forschung überbrückter Graben. Ein Konzept zur Beschreibung und letztlich auch Messung von Public Value fehlt. Somit ist auch die Frage noch nicht zu beantworten, ob dieser Begriff ein geeigneter Leitwert für den öffentlichen Medienauftrag sein kann.
Der Programmauftrag gemeinschaftsfinanzierter Medienunternehmen kann in einer Gesellschaft, deren Kommunikationsmedien durch Computernetzwerke gesteuert werden, nicht auf die Verbreitung von Inhalten und deren Qualitätsbeschreibung beschränkt bleiben. Die bestehenden Internet-Plattformen haben Kommunikationsgewohnheiten etabliert, die nicht als modische Accessoires abgetan werden können. Dazu gehört der Umgang mit Personalisierungsangeboten, vor allem aber die Dialogmöglichkeit letztlich aller mit allen, die auch für diejenigen unverzichtbar ist, die sich nur gelegentlich aktiv in Dialogen äußern. Die dialogische Struktur der vernetzten Kommunikation und die Verbreitungslogik der Massenmedien sind nicht durch Kompromisse oder die seit den 1990er Jahren vielbeschworene „Konvergenz“ zusammenzuzwingen. Die Medienentwicklung verläuft evolutionär und erfordert Anpassungsleistungen um den Preis von Akzeptanz- und Legitimationsverlusten. Der Übertritt von der Verbreitungssphäre in die Dialogsphäre ist gleichbedeutend mit dem Wechsel von Perspektiven und Haltungen. Die allwissenden Gatekeeper und abgehobenen Verkünder weichen den dialogbereiten und dialogfähigen Kommunikationspartnern. Daraus ergäbe sich auch eine angemessene Leitidee für den Medienauftrag. Sie könnte einfach als aktive Orientierung an den Kommunikationsformen und Erwartungen des Publikums beschrieben werden.
IV Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach hervorgehoben, dass eine „Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ besteht und diese „sich auch auf neue Dienste mittels neuer Techniken (erstreckt), die künftig Funktionen des herkömmlichen Rundfunks übernehmen können“. Diese Formulierung bezog sich ursprünglich auf potentielle neue Mediendienste im Breitbandkabel, dessen Ausbau und prinzipielle Rückkanalfähigkeit in den 1980er Jahren viel diskutiert wurde. In Verbindung mit der Entwicklungsgarantie steht der verfassungsrechtliche „Funktionsauftrag“ an den Rundfunk, der einen Beitrag zur Vielfalt meinungsbildender Angebote verlangt. Das normative Ziel der Vielfaltsicherung kann allerdings nur erfüllt werden, wenn eine Akzeptanz des Publikums vorhanden ist. Funktionen des herkömmlichen Rundfunks werden inzwischen von Diensten übernommen, die von ihrer Grundstruktur her keine linearen Verbreitungsmedien mehr sind. Unter diesen Umständen genügt es nicht, dem Rundfunk die technische und organisatorische Weiterentwicklung zu gewähren. Angesichts des Medienwandels und der Verschiebungen auf den Publikumsmärkten muss daher die Entwicklungsgarantie als Innovationsauftrag verstanden werden.
Zum einen müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Entwicklung angepasst werden. Wie dies auch unter den Bedingungen der europäischen Beihilfe-Richtlinien möglich ist, hat das Konvergenz-Gutachten von Winfried Kluth und Wolfgang Schulz bereits Ende 2014 gezeigt. Dort wird vorgeschlagen, nicht mehr von Angebotstypen – Presse, Rundfunk, Telemedien – auszugehen, sondern neue Kategorien für Regelungsziele zu entwickeln. Zur Kategorie der „journalistisch-redaktionellen Telemedien“ gehörten dann entsprechende Angebote aus dem Rundfunk, aus Verlagen und anderen Quellen, deren Qualitätskriterium ihr besonderer Wert für die öffentliche Kommunikation darstellt. Für die Angebote aus dem heute noch so genannten Rundfunk ist es dabei unmaßgeblich, ob es sich um lineares oder nicht-lineares Programm handelt.
Zum anderen erweisen sich auch die bislang verwendeten Begriffe der rundfunkrechtlichen Regelungsziele als problematisch, da sie von den sozioökonomischen und massenmedialen Bedingungen ihrer Entstehungszeit geprägt sind. Bis in die 1990er Jahre hinein mag das korporatistische Ideal der Integration noch ein Echo in der Gesellschaft gefunden haben. Heute erwartet die Gesellschaft eher den Dialog. Die Sicherung von Vielfalt und Ausgewogenheit der Meinungen und kulturellen Angebote in den Medien war unter den Bedingungen einer technisch begrenzten Anzahl von Kanälen eine nachvollziehbare Anforderung. Heute findet sich in der Breite der digitalen Medienangebote eine größere Vielfalt als je zuvor, wichtiger wird – angesichts der Konzentration von Inhalten auf globalen Plattformen – jedoch die Auffindbarkeit und die Integrität verlässlicher Quellen.
Die Entwicklung neuer Begriffe für die Aufgaben gemeinschaftsfinanzierter Unternehmen ist ebenso wichtig wie ihre organisatorische Transformation und ein Perspektivwechsel in ihren Programmstrategien. Mit einer „Strukturoptimierung“ lässt sich die Zukunft weder begreifen noch erobern. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen arbeiten am Entwurf einer künftigen Medienlandschaft, in der sie noch eine nennenswerte Rolle spielen könnten, nicht mit, sondern ziehen sich auf einen Opferdiskurs zurück. Der Hamburgische Senator für Kultur und Medien, Karsten Brosda, hat den Management-Slogan „Innovate or die“ in eine milde Mahnung übersetzt: „Die Fähigkeit zum Wandel ist die entscheidende Voraussetzung dafür, das Bestehende sinnvoll zu sichern.“
Ganz im Sinne dieser Botschaft verhält sich die BBC. Ihr „Annual Plan“ für 2018/19 ist voller innovativer Ideen und enthält den bemerkenswerten Satz: „We must be ready for an internet-only world whenever it comes – and it is coming soon – but we must try to serve all our audiences brilliantly in the transition.“ Indirekt sind hier die beiden größten Defizite der deutschen Situation benannt: Es fehlt die Definition der eigenen aktiven Rolle im rapiden Transformationsprozess der Medien und die Orientierung an den legitimen Erwartungen des immer dialogbereiter werdenden Publikums.
Eine neue Leitidee für den Rundfunk
Wer gehofft hatte, in diesem Sommer eine medienpolitische Wende zu erleben, sieht sich getäuscht. Es liegen keine neuen Konzepte auf dem Tisch, die dem heutigen Rundfunk eine Zukunft im Netz der Netze bahnen. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die eigens zu Strukturüberlegungen aufgefordert wurden, die über organisatorische Optimierungen hinausgehen, verweigern den Zukunftsdiskurs und legen ihr Schicksal in die Hände von Medienpolitikern und Lobbyisten. Untote Begriffe geistern durch die Papiere: die Presseähnlichkeit und der Sendungsbezug. Mittlerweile ist die Entwicklungsdynamik der digitalen Medienumgebungen, in denen Presse und Sendungen keine Rolle mehr spielen, ungebrochen. Die öffentlichen Rundfunkunternehmen jedoch graben sich ein und hoffen offenbar, ihren Besitzstand so am besten verteidigen zu können.
I Zukunftsfähige Veränderungen des Rundfunksystems müssen an seinem Zentrum ansetzen, am rundfunkrechtlichen Programmauftrag. Alles andere – Organisation, Kooperationen, Verwertungsstrategien – ist demgegenüber zweitrangig. Der bestehende Programmauftrag ist in der deutschen Rundfunkgeschichte verankert und in Begriffe gefasst, die ebenso hinterfragt werden müssen wie die Ziele des Auftrags. Die Schlüsselbegriffe des Rundfunkrechts sind zwischen 1961 und 1994 eingeführt worden, der Blütezeit der Massenmedien. Für die Welt der Massenmedien und ihre spezielle Konfiguration in Deutschland lieferten sie auch zeitgemäße Orientierungen. Wie können aber unter den heutigen, durch Netzwerkmedien bestimmten Kommunikationsverhältnissen „Vielfalt“ und „Integration“ noch produktiv gemacht werden?
Zur veralteten Begriffswelt rechtlicher Medienbeschreibungen gehört die Präambel des Rundfunkstaatsvertrags, worauf die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach, mehrfach hingewiesen hat. Dort finden sich noch Anklänge an eine Medienlandschaft, in der es außer der Presse nur das unter Frequenzknappheit leidende duale Rundfunksystem gab. Andererseits gibt die Präambel einen Hinweis, der als Anstoß zur Innovation verstanden werden kann.
Beide Rundfunksysteme – das öffentlich-rechtliche und das private, so heißt es da – „müssen in der Lage sein, den Anforderungen des nationalen und des internationalen Wettbewerbs zu entsprechen“. Nun setzen gerade internationale Wettbewerber wie Netflix, Spotify und Amazon beide deutschen Rundfunksysteme unter Druck, und diese versuchen, mit neuen Konzepten auf die Wanderungsbewegung des Publikums zu reagieren. Für viele Studierende ist beispielsweise ein Netflix-Abo selbstverständlich, nicht aber ein eigenes Fernsehgerät. Ob mit dem Ausbau bestehender Mediatheken oder der Gründung neuer übergreifender Plattformen etwas erreicht werden kann, hängt auch davon ab, ob deutsche Rundfunkanbieter online erfolgversprechende Handlungsmöglichkeiten haben. Diese sind zumindest den öffentlich-rechtlichen Anstalten verwehrt. Der Rundfunkauftrag bezieht sich primär auf lineare Sendungen. Programm wird im §2 des Rundfunkstaatsvertrags als „eine nach einem Sendeplan zeitlich geordnete Folge von Inhalten“ beschrieben.
Unter diesen Bedingungen bleiben Online-Angebote grundsätzlich ein Annex des linearen Programms – mit einer Ausnahme, dem speziell beauftragten Jugendangebot FUNK. Die aktuellen Mediatheken der Sender enthalten Sendungen oder Sendungsfragmente, die für die lineare Verbreitung produziert wurden. Sie sind keine eigenständige Programminstanz und dürfen das auch gar nicht sein. Es wäre jedoch Zeit für einen rechtlichen und faktischen Perspektiv- und Paradigmawechsel. Wenn der Programmbegriff aus der Linearität entlassen wird, „Programm“ also alles das sein darf, was im Rahmen des gesetzlichen Auftrags produziert wird, ist die Gründung von Programmdirektionen bzw. Gemeinschaftseinrichtungen für Mediatheken und Audiotheken der nächste konsequente Schritt. Diese müssen dann finanziell so ausgestattet werden, wie es der absehbaren Bedeutung dieser Einrichtungen für das Publikum entspricht. Die Aufgabe der Mediatheken wäre nicht nur die Zweitverwertung von „Sendungen“, sondern auch die Eigenproduktion von Beiträgen und „Kanälen“ – und darüber hinaus die intensive Interaktion mit den Nutzern.
II Den Verfassungsjuristen ist es im Laufe der Jahrzehnte seit dem ersten Rundfunkurteil 1961 gelungen, aus einem einzigen Satz des Grundgesetz-Artikels 5 – Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet – eine umfangreiche Definition von Rundfunkaufgaben abzuleiten. Darunter fallen ein Grundversorgungs- und Funktionsauftrag, Leistungen zur Förderung der gesellschaftlichen Integration, Beiträge zur Sichtbarmachtung vielfältiger Meinungen und die Bestimmung des Verhältnisses von öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Rundfunkmedien – um nur einige zu nennen. Dabei wurde auch mehrfach die Rechtsform bestätigt, die der Rundfunk ursprünglich durch das britische Besatzungsregime erhielt. Sie wurde allerdings vom Bundesverfassungsgericht als jederzeit durch ein anderes Modell ablösbar bezeichnet. Die jetzigen Anstalten müssen den Widerspruch ausbalancieren, „Aufgaben der öffentlichen Verwaltung“ wahrnehmen zu sollen (wie es im 2. Rundfunkurteil von 1971 heißt) und andererseits das Gebot der Staatsferne umzusetzen, das zuletzt im ZDF-Urteil des Verfassungsgericht von 2014 bestätigt wurde.
Der ebenfalls 1971 formulierte Auftrag, eine „integrierende Funktion für das Staatsganze“ zu erfüllen, zielt auf die Mitwirkung des Rundfunks an der Erhaltung der staatlichen Gewaltenteilung. Die erwünschten Leistungen eines unparteilichen, „binnenplural“ verfassten Massenmediums werden dabei modellhaft mit der Vorstellung einer aus Institutionen (und nicht aus Individuen) kombinierten Gesellschaft zusammengeschaltet. Offenkundig hat dieses Modell den Bezug zu den aktuellen gesellschaftlichen Konstellationen eingebüßt. Jene Institutionen, deren Vertreter in plural zusammengesetzten Gremien die Aufsicht über die öffentlich-rechtlichen Anstalten führen sollen, verlieren rapide an Bedeutung. Die Zahl der Mitglieder von Gewerkschaften und Parteien hat sich seit 1990 halbiert, Kirchen spielen keine Rolle mehr bei der Meinungsbildung in gesellschaftlichen Fragen, und früher einflussreiche Periodika dieser Organisationen sind verschwunden. Neue Akteure der Meinungsbildung sind jetzt „zivilgesellschaftliche“ Gruppierungen. Netzpolitische Aktivisten und Pulse of Europe, Pegida und die Unterzeichner der „Gemeinsamen Erklärung 2018“ machen Angebote für identitäre Bestrebungen, bilden dabei aber keine Institutionen, die zeitlich und organisatorisch so stabil sind wie die vorgenannten. Wenn durch die etablierte binnenplurale Aufsichtsform nur noch eine Minderheit der Gesellschaft repräsentiert wird, stellt sich unter anderem die Frage, ob durch sie die innere Pressefreiheit in diesen Unternehmen noch garantiert werden kann. Die Fiktion der institutionalisierten Öffentlichkeit, die den Integrationsauftrag gespeist hat, kann in einer vernetzten und zunehmend ent-institutionalisierten Gesellschaft kaum noch aufrechterhalten werden. Eine Leitidee, die auf den Nutzen der Medien für die Gesellschaft statt auf den Nutzen für das „Staatsganze“ ausgerichtet ist, wäre der neuen Lage viel angemessener.
III Ein angesichts der sich entwickelnden digitalen Medienkultur zunehmendes Problem des deutschen Rundfunkauftrags ist der hohe Ton seiner Ansprüche. Der Rundfunk soll „Faktor“ und „Medium“ der Meinungsbildung sein und wird geradezu als demokratiekonstituierend dargestellt, da eine durch ihn ermöglichte vielfältige „öffentliche Meinung“ entscheidend sei für eine demokratische Willensbildung. Insofern erfülle der Rundfunk eine „öffentliche Aufgabe“. Welchen Dienst er der Gesellschaft leisten kann, welche Wünsche und Bedürfnisse der von ihm adressierten Kommunikationsgemeinschaft er erfüllt und welchen Wert er auch deshalb für die Gesellschaft bereitstellt, kommt in diesen psalmodierenden Beschreibungen nicht vor.
In den letzten beiden Jahrzehnten fällt auch in deutschen Fachdiskussionen häufig der Begriff Public Value. Er geht unter anderem auf Arbeiten des amerikanischen Politik- und Wirtschaftswissenschaftlers Mark Harrison Moore zurück. Dieser fragte, welche Werte der Gesellschaft und ihren Mitgliedern entgehen, wenn öffentliche Aufgaben (Bibliotheken, Wasserversorgung, öffentliche Sicherheit etc.) privatisiert und unter das Regime betriebswirtschaftlicher Kalkulationen gestellt werden. Die Erfüllung der erwähnten „öffentlichen Aufgabe“ im Bereich der Willensbildung könnte als deutsche Variante des Public Value interpretiert werden. In Frankreich würde sicher der kulturelle Wert fokussiert (z. B. im Hinblick auf die französische Filmproduktion), in Großbritannien eher der wirtschaftliche Nutzen, den die Medienbranchen durch gemeinschaftlich finanzierte Medien erfahren. Moore hob zusätzlich einen Aspekt des Public-Value-Begriffs hervor, seine Plastizität, die sich aus der jederzeit notwendigen neuen Aushandlung seiner Bedeutung herleitet. Um die Tauglichkeit des Public-Value-Konzepts zur Neubestimmung eines Leitbegriffs für gesellschaftlich gestützte Medien zu erproben, wären nach Moores Muster die Verluste abzuschätzen, die eine Gesellschaft beim Wegfall dieser Medien erführe. Eben diese Fragestellung mobilisierte das Wahlvolk in der Schweiz vor der NoBillag-Abstimmung, die mit einer über 70-prozentigen Bestätigung der gemeinschaftlichen Finanzierung endete.
Moores Evaluierungsvorschlag für den Public Value von Unternehmen zielt auf die Kombination von drei Verfahren: Die Ermittlung der Zufriedenheit der aufsichtsführenden Körperschaft mit der Leistung des Unternehmens, die Bewertung der Ergebnisse durch das Management z. B. mithilfe von Kosten-Nutzen-Analysen und die Messung der Zufriedenheit von Kunden und Nutzern. Dem entspricht das von Moore ins Spiel gebrachte Dreieck von Legitimation, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz, in dem sich Public Value zu bewähren hat.
Eine Nutzenbestimmung nach einem breit angelegten Public-Value-Konzept, das nicht aus der Perspektive staatlicher Reproduktionsbedürfnisse gedacht ist, könnte nach vorn weisen. Dieser Gedanke wird auch in einer 500 Seiten starken Doktorarbeit im europäischen Vergleich untersucht. Die Autorin Christiana Gransow stellt für Deutschland fest, dass der Begriff aufgrund verschiedener terminologischer Bedenken nicht in das Rundfunkrecht aufgenommen wurde. Stattdessen wurde in den Dreistufentestverfahren der äußerst vage „qualitative Beitrag zum publizistischen Wettbewerb“ eingeführt. Für öffentlich-rechtliche Telemedienangebote ist der Nachweis zu erbringen, dass sie „den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen“. Im tatsächlichen Umgang mit dieser Anforderung beschränken sich die Sender und ihre Aufsichtsgremien allerdings auf die Verabschiedung selbsterstellter Inhaltsanalysen von Programmkategorien. Diese sagen jedoch kaum etwas darüber aus, welchen Wert das Programm für die Gesellschaft besitzt. So schwierig die von Moore vorgeschlagene Messung der Zufriedenheit der Mediennutzer methodisch auch ist, sie besäße doch einen höheren Auskunftswert als Selbstbeschreibungen und Absichtserklärungen der Unternehmen. Auch durch die Ermittlung der Meinungsbilder von Rundfunkräten lassen sich methodisch durchdachte qualitative und quantitative Nutzerstudien sicher nicht ersetzen. Derzeit bleibt zwischen dem Benchmarking der Anbieter und dem Wertempfinden des Publikums ein noch durch keine Forschung überbrückter Graben. Ein Konzept zur Beschreibung und letztlich auch Messung von Public Value fehlt. Somit ist auch die Frage noch nicht zu beantworten, ob dieser Begriff ein geeigneter Leitwert für den öffentlichen Medienauftrag sein kann.
Der Programmauftrag gemeinschaftsfinanzierter Medienunternehmen kann in einer Gesellschaft, deren Kommunikationsmedien durch Computernetzwerke gesteuert werden, nicht auf die Verbreitung von Inhalten und deren Qualitätsbeschreibung beschränkt bleiben. Die bestehenden Internet-Plattformen haben Kommunikationsgewohnheiten etabliert, die nicht als modische Accessoires abgetan werden können. Dazu gehört der Umgang mit Personalisierungsangeboten, vor allem aber die Dialogmöglichkeit letztlich aller mit allen, die auch für diejenigen unverzichtbar ist, die sich nur gelegentlich aktiv in Dialogen äußern. Die dialogische Struktur der vernetzten Kommunikation und die Verbreitungslogik der Massenmedien sind nicht durch Kompromisse oder die seit den 1990er Jahren vielbeschworene „Konvergenz“ zusammenzuzwingen. Die Medienentwicklung verläuft evolutionär und erfordert Anpassungsleistungen um den Preis von Akzeptanz- und Legitimationsverlusten. Der Übertritt von der Verbreitungssphäre in die Dialogsphäre ist gleichbedeutend mit dem Wechsel von Perspektiven und Haltungen. Die allwissenden Gatekeeper und abgehobenen Verkünder weichen den dialogbereiten und dialogfähigen Kommunikationspartnern. Daraus ergäbe sich auch eine angemessene Leitidee für den Medienauftrag. Sie könnte einfach als aktive Orientierung an den Kommunikationsformen und Erwartungen des Publikums beschrieben werden.
IV Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach hervorgehoben, dass eine „Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ besteht und diese „sich auch auf neue Dienste mittels neuer Techniken (erstreckt), die künftig Funktionen des herkömmlichen Rundfunks übernehmen können“. Diese Formulierung bezog sich ursprünglich auf potentielle neue Mediendienste im Breitbandkabel, dessen Ausbau und prinzipielle Rückkanalfähigkeit in den 1980er Jahren viel diskutiert wurde. In Verbindung mit der Entwicklungsgarantie steht der verfassungsrechtliche „Funktionsauftrag“ an den Rundfunk, der einen Beitrag zur Vielfalt meinungsbildender Angebote verlangt. Das normative Ziel der Vielfaltsicherung kann allerdings nur erfüllt werden, wenn eine Akzeptanz des Publikums vorhanden ist. Funktionen des herkömmlichen Rundfunks werden inzwischen von Diensten übernommen, die von ihrer Grundstruktur her keine linearen Verbreitungsmedien mehr sind. Unter diesen Umständen genügt es nicht, dem Rundfunk die technische und organisatorische Weiterentwicklung zu gewähren. Angesichts des Medienwandels und der Verschiebungen auf den Publikumsmärkten muss daher die Entwicklungsgarantie als Innovationsauftrag verstanden werden.
Zum einen müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Entwicklung angepasst werden. Wie dies auch unter den Bedingungen der europäischen Beihilfe-Richtlinien möglich ist, hat das Konvergenz-Gutachten von Winfried Kluth und Wolfgang Schulz bereits Ende 2014 gezeigt. Dort wird vorgeschlagen, nicht mehr von Angebotstypen – Presse, Rundfunk, Telemedien – auszugehen, sondern neue Kategorien für Regelungsziele zu entwickeln. Zur Kategorie der „journalistisch-redaktionellen Telemedien“ gehörten dann entsprechende Angebote aus dem Rundfunk, aus Verlagen und anderen Quellen, deren Qualitätskriterium ihr besonderer Wert für die öffentliche Kommunikation darstellt. Für die Angebote aus dem heute noch so genannten Rundfunk ist es dabei unmaßgeblich, ob es sich um lineares oder nicht-lineares Programm handelt.
Zum anderen erweisen sich auch die bislang verwendeten Begriffe der rundfunkrechtlichen Regelungsziele als problematisch, da sie von den sozioökonomischen und massenmedialen Bedingungen ihrer Entstehungszeit geprägt sind. Bis in die 1990er Jahre hinein mag das korporatistische Ideal der Integration noch ein Echo in der Gesellschaft gefunden haben. Heute erwartet die Gesellschaft eher den Dialog. Die Sicherung von Vielfalt und Ausgewogenheit der Meinungen und kulturellen Angebote in den Medien war unter den Bedingungen einer technisch begrenzten Anzahl von Kanälen eine nachvollziehbare Anforderung. Heute findet sich in der Breite der digitalen Medienangebote eine größere Vielfalt als je zuvor, wichtiger wird – angesichts der Konzentration von Inhalten auf globalen Plattformen – jedoch die Auffindbarkeit und die Integrität verlässlicher Quellen.
Die Entwicklung neuer Begriffe für die Aufgaben gemeinschaftsfinanzierter Unternehmen ist ebenso wichtig wie ihre organisatorische Transformation und ein Perspektivwechsel in ihren Programmstrategien. Mit einer „Strukturoptimierung“ lässt sich die Zukunft weder begreifen noch erobern. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen arbeiten am Entwurf einer künftigen Medienlandschaft, in der sie noch eine nennenswerte Rolle spielen könnten, nicht mit, sondern ziehen sich auf einen Opferdiskurs zurück. Der Hamburgische Senator für Kultur und Medien, Karsten Brosda, hat den Management-Slogan „Innovate or die“ in eine milde Mahnung übersetzt: „Die Fähigkeit zum Wandel ist die entscheidende Voraussetzung dafür, das Bestehende sinnvoll zu sichern.“
Ganz im Sinne dieser Botschaft verhält sich die BBC. Ihr „Annual Plan“ für 2018/19 ist voller innovativer Ideen und enthält den bemerkenswerten Satz: „We must be ready for an internet-only world whenever it comes – and it is coming soon – but we must try to serve all our audiences brilliantly in the transition.“ Indirekt sind hier die beiden größten Defizite der deutschen Situation benannt: Es fehlt die Definition der eigenen aktiven Rolle im rapiden Transformationsprozess der Medien und die Orientierung an den legitimen Erwartungen des immer dialogbereiter werdenden Publikums.
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
