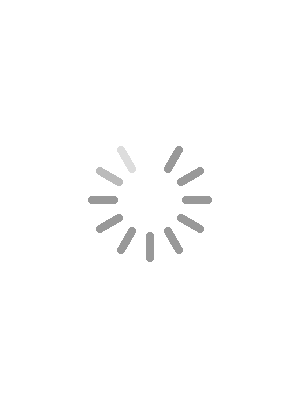
Jochen Hörisch
Radio live

Radio live. Von Jochen Hörisch: „Tor! Toor!! Tooor!!! Tooor!!!! TOOOOOR!!!!!“ Wenn man beschreiben, beschwören, evozieren will, was mit der Formel „Radio live“ gemeint ist, kann man kaum anders als an die sich überschlagende, enthemmte, enthusiastische Stimme des legendären Radioreporters Herbert Zimmermann zu denken, der am 4. Juli 1954 aus dem Wankdorf-Stadion in Bern über das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft zwischen Ungarn und Deutschland berichtet. Berichtet? Nein: das Ereignis stimmlich beschwört, Präsenz herstellt, reale Gegenwart stiftet. Ein Medienereignis ersten Ranges ist die Fußballweltmeisterschaft von 1954 auch deshalb, weil sie als Radio-Ereignis ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist (und übrigens auch in das private Gedächtnis des damals Dreijährigen, der heute zu Ihnen spricht, es ist eine meiner frühsten Kindheitserinnerungen überhaupt). Bemerkenswert ist dies schlicht deshalb, weil das mythische Endspiel ja auch damals schon direkt im Fernsehen übertragen wurde – von der gerade einmal zwei Jahre alten ARD, welchem Sender sonst, es gab damals in Deutschland keinen zweiten Sender. Eine konservierbare Fernsehaufzeichnung aber war, anders als die dioreportage, damals technisch noch nicht möglich. Den überlieferten Filmaufnahmen vom legendären Fußballspiel wird zumeist die Stimme des Radioreporters unterlegt, ist die doch kaum zu toppen: „Sechs Minuten noch im Wankdorf-Stadion in Bern, keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder, es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht(sic!) aus“. Da produziert der Radioreporter einen hübschen Versprecher: „sie harren NICHT aus“. Er meint offenbar, dass es die Zuschauer im Stadion von den Sitzen reißt, und nicht, dass sie das Stadion verlassen. Live-Sendungen sind auch deshalb so spannend, weil sie stets das Sprechen mit dem Versprechen kombinieren. Lauschen wir dennoch oder gerade deshalb weiter gebannt der Reporterstimme:„ Wie könnten sie auch – eine Fußball-Weltmeisterschaft ist alle vier Jahre und wann sieht man ein solches Endspiel, so ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zu Morlock wird von den Ungarn abgewehrt – und Bozsik, immer wieder Bozsik, der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball – verloren diesmal, gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball – abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen – Rahn schießt – Tooooor! Tooooor! Tooooor! Tooooor!“ Radio dient, wie alle Medien, der Absenzüberbrückung. Wir schreiben Briefe oder ein Testament, weil wir nicht dort sind, wo wir gerne wären: bei der Liebsten oder mitten im Leben. Fernsehen ist ein wunderbar präziser Begriff: wir sehen mit Hilfe dieser Medientechnik in ferne Weiten, die sich unserem Auge sonst verschließen würde. Selbstredend ist auch das Radio ein Medium, das Abwesenheiten überbrückt. Die vielen Millionen, die 1954 gerne im Berner Fußballstadion dabei, also anwesend gewesen wären, konnten ihre schmerzhaft empfundene Abwesenheit zumindest halbwegs kompensieren – dem Radio sei Dank. Es stellte ihnen stimmlich Bilder vor Augen, die schöner waren als die verregnete Wirklichkeit. Wer dialektisch begabt ist, kann die Faszination, die von Medien aller Art ausgeht, damit erklären, dass sie Abwesenheit abwesend werden lassen. Unter allen Absenzen überwindenden Medien ist das Radio das Medium der Geistesgegenwart schlechthin. Und dies aus einem ebenso traditionsträchtigen wie suggestiven Grund. Die Stimme und der Ton gelten gerade deshalb, weil sie in dem Augenblick, in dem sie erklingen, auch schon verklungen sind, als die Präsenzmedien schlechthin. Scripta manent, verba volant, sagten die alten Römer: die Schriften bleiben, die gesprochenen Worte aber verfliegen sofort. Wer schreibt, bleibt; wer spricht, nicht. Gerade weil sie verfliegen und so flüchtig sind, beschwören Stimmen Gegenwart, Präsenz oder – um den heute so beliebten und aussagekräftigen Begriff zu bemühen – das, was wir „live/life“ nennen. „Kommt reden wir zusammen, / Wer redet, ist nicht tot“ lauten die berühmten Eingangsverse des Gedichts Kommt von Gottfried Benn. Das Radio lebt – und es lebt davon, dass es wie kein anderes Medium Stimmungen über Stimmen beschwören kann. Seine Monopolstellung in Sachen live-Übertragung aber hat das Radio in den letzten Jahrzehnten unwiederbringlich verloren. Live-Übertragungen – die schafft das Fernsehen auch, das gibt’s zunehmend auch im Internet. Zu den Eigentümlichkeiten des Internets gehört es, die Langsamkeit der Schrift der schnellen Präsenz von Stimmen anzunähern. Auf Internetforen und in Blogs (um vom Twittern zu schweigen) wird fast so schnell schriftlich wie mündlich kommuniziert. Das Radio hat sich auf diese Konkurrenz eingestellt. Zu seinen eigentümlichen jüngeren Reizen gehört es, buchstäblich Zweitpräsenzen zu stiften. Soll heißen: wir stehen im Stau und sehen, was man halt im Stau so sieht: Autos vor, hinter und neben uns. Und in dieser geistlosen Situation hört man zugleich aus dem Radio wenn nicht das ganz Andere, so doch anderes: etwa Töne, die höher sind als alle Verkehrsvernunft, oder Stimmen, die klassische Texte vortragen, oder Köpfe, die diskutierend, analysierend, berichtend oder rezensierend sich und uns etwas zu sagen haben. Und ab und an den Verkehrsfunk, der sagt, was wir eh schon sehen. Nur dann, nur bei solchen Verdoppelungen und Redundanzen, ist das Radio nicht im Umkreis seiner Stärke. Es ist das Sekundärmedium schlechthin. Vieles aber spricht dafür, dass heute schwer auszumachen ist, was primär bzw. sekundär genannt zu werden verdient.
Hörisch: Radio live
#1414 / O-Ton / mit Geodaten / Dokublog
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
