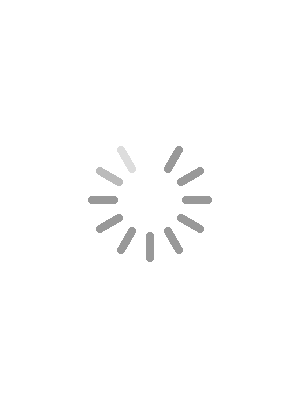
Jürg Häusermann
Sprechen im Radio

(O-Ton: Ausschnitt aus der Sendung "Train bleu", Radio de la Suisse Romande, 26. 11. 2000) Das ist die Stimme von Bernard Pichon – einem der Helden dieses Beitrags. Das ist einer, dem es gegeben ist, den Hörer direkt und unmittelbar anzusprechen. Mit seiner Stimme nutzt er die Gesetze des Radios, die so ähnlich sind und so anders als die des Sprechens im Alltag. Wenn im Alltag zwei Menschen miteinander reden, ergibt sich vieles von selbst. Die Gesprächspartner teilen einen kleinen, persönlichen Raum, und sie achten automatisch auf die richtige Lautstärke und das passende Tempo. Ganz anders ist es in der öffentlichen Situation, z.B. bei einem Vortrag. Der Redner muss allein dafür sorgen, dass er seine Rede den gemeinsamen Raum füllt und dass sie das Publikum erreicht. Weil sich mit der öffentlichen Aufgabe die Raumverhältnisse verändert haben, sind auch die Anforderungen an die Sprechweise ganz andere. Wer im Radio redet, hat es nochmals etwas schwerer. Er befindet sich im Studio; seine Zuhörer aber bewegen sich in ihren eigenen Räumen: zu Hause am Lautsprecher – oder unterwegs, in der Intimität, die der Kopfhörer schafft. Die Aufgabe für Radio-Sprecherinnen und Sprecher besteht nun darin, eine Verbindung zwischen ihrem eigenen und diesen fremden Räumen herzustellen. Dies gelingt, wenn sie die "öffentliche" Sprechweise zurücknehmen und wieder eher sprechen wie im persönlichen Gespräch. Im besten Fall entsteht dabei eine Nähe, als ob es nur noch einen gemeinsamen Raum gäbe. Am leichtesten erreicht man dies, wenn man nicht allein ist und eine entsprechende räumliche Inszenierung schaffen kann. Für mich stammt das klassische Beispiel aus dem französischsprachigen Radio. Dem Radiomann Bernard Pichon gelangen beeindruckende Porträts, indem er seine Interviewpartner bat, für die Aufnahme einen Ort vorzuschlagen, der ihnen etwas bedeutete. So wählte etwa der Sänger Pierre Perret eine Konzerthalle, in der er schon oft aufgetreten war. Man führte das Gespräch im Foyer, vor, auf und hinter der Bühne. In solchen Aufnahmen ist der Raum für alle, für den Interviewer, den Porträtierten und den Zuhörer, ständig präsent. Der Raum ist Thema, ist Geräuschkulisse und er ist Regulativ ' für Lautstärke, Sprechtempo, Pausen usw. Das Wichtigste vielleicht: Die Beteiligten müssen nicht nur reden, sondern auch hinhören: Die Gesprächspartner achten aufeinander und auf den Raum um sie herum. Damit nehmen sie ihr Publikum fast automatisch mit. Das ist das Geheimnis guter Radiosprache: Räume teilen, Räume erfahrbar machen, indem man gemeinsam mit dem Hörer lauscht. Am direktesten lässt sich das in der Live-Reportage umsetzen: da, wo Reporter von öffentlichen Veranstaltungen berichten (zum Beispiel aus einer Kirche oder einem Versammlungslokal) und dabei automatisch mit Wortwahl, Stimme und prechtempo auf den Raum eingehen und die Zuhörer mit hereinholen. Aber auch in den alltäglichen Begleitprogrammen gibt es Moderatorinnen und Moderatoren, die nicht einfach Musik oder Textbeiträge ansagen, sondern deutlich machen, dass sie zusammen mit ihrem Publikum die Stücke hören. Bei vielen Informationsbeiträgen ist der Umgang mit dem O-Ton entscheidend. Es gibt zwar unzählige Radiobeiträge, in denen Interview-Ausschnitte, wie Zitate, in den eigenen Text eingebaut sind. Aber hin und wieder gelingt den Autoren noch etwas mehr: Sie gehen zusammen mit dem Zuhörer auf Augenhöhe der Informanten, und da setzen sie sich nochmals mit ihnen auseinander. Dies lässt Szenen entstehen, die einen nicht so leicht loslassen. Einigen wenigen ist es schließlich gegeben, diese Intensität auch dann entstehen zu lassen, wenn sie nur ein einfaches Manuskript vor sich haben. Sie schaffen einen gemeinsamen Raum, weil sie nicht einfach ablesen, sondern den Hörer in ihre Gedankenwelt mitnehmen. Sie überwinden das Einwegmedium und laden zum Gespräch ein – jenseits von allen interaktiven Spielchen – weil ihnen wichtig ist, die Hörerinnen und Hörer zu gewinnen und mit ihnen einen Raum zu teilen und zu gestalten.
Sprache im Radio
#1634 / O-Ton / mit Geodaten / Dokublog
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
