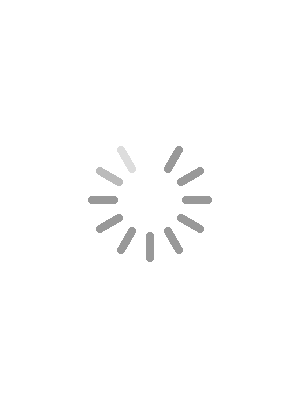
Lang lebe das Radio!
Ein Kurz-Essay von Ania Mauruschat

Lang lebe das Radio
Von Ania Mauruschat
1921, kurz vor seinem Tod, verfasste der russische Avantgarde-Dichter Velimir Chlebnikov einen euphorischen Text über das damals neueste Medium und seine Verheißungen. „Radio der Zukunft“ heißt dieses Manifest, in dem Chlebnikov u.a. überschwänglich ein Geschmacks- und Geruchsradio imaginiert, das irgendwann sogar den „Honigduft einer Linde“ vermischt mit dem „Geruch des Schnees“ übertragen und so den Radioempfängern in der russischen Steppe den härtesten Winter versüßen werde. Was den Dichter jedoch am meisten an diesem Medium fasziniert, ist seine soziale Dimension. Chlebnikov schwärmt von Radiolesesälen, Radiohörsälen und Radioklubs. Er ist davon überzeugt, dass der „große Zauberer“, wie er das Radio nennt, - Zitat - „die Glieder der Weltseele schmieden und die Menschheit zu einer Einheit verschmelzen“ werde.
Dieses soziale Moment, die Herstellung einer neuen Art von Gemeinschaft, die mit dem Radio möglich geworden war, faszinierte von Anfang an auch andere Künstler. Sie liegt z.B. auch Bertolt Brechts Überlegungen zu einer Radiotheorie zugrunde, wenn der Dramatiker und Lyriker fragt wie man den Distributionsapparat in einen echten Kommunikationsapparat verwandeln könne, so dass jeder Empfänger auch zum Sender werde. In seinem Hörspiel „Der Lindberghflug“ (später umbenannt in „Der Ozeanflug“), das Brecht gemeinsam mit den Komponisten Kurt Weill und Paul Hindemith schrieb, und das 1929 in Baden-Baden uraufgeführt wurde, ging es genau darum: Das Potential des neuen Mediums Radio in Sachen Interaktivität und Gemeinschaftlichkeit zu erforschen und auszutesten. So wurden die Hörer z.B. nicht mehr, wie bisher v.a. im Theater, als passive Empfänger angesehen, sondern aktiviert und zu einander in Beziehung gesetzt, u.a. dadurch, dass sie zu Hause vor ihren Empfangsgeräten die fehlenden Textpassagen sprechen oder das fehlende vierte Instrument eines Quartetts spielen sollten.
Rund 100 Jahre später sieht die Realität des Radios anders aus: Statt „Honigduft der Linde“ sendet es Werbung für Lindenhonig, anstatt den Geruch von Schnee zu übertragen, informiert es über das Schmelzen der Polkappen in Zeiten der Klimakatastrophe. Radio wird v.a. vereinzelt und individualisiert gehört, ob im Bad, in der Küche oder im Auto. Die Digitalisierung verstärkt insbesondere diese Tendenz zum perfektionierten, reibungslosen, individualisierten und effizienten Konsum. Dank DAB, Digital Audio Broadcasting Technologie, gibt es keine Funklöcher mehr im Autobahntunnel, dank Podcast ist niemand mehr an eine Sendezeit gebunden. Jeder kann sich jederzeit die verpasste Folge oder alle Teile einer Sendung auf einmal aus dem Internet herunterladen und über Kopfhörer z.B. beim Pendeln in der U-Bahn hören, um so auch noch das letzte Zeitfenster in einem durchgetakteten Arbeitstag optimal zu füllen und auszunutzen.
Dabei zeichnet sich der Podcast als neue Kunstform der Hörspiel- und Feature-Abteilungen dadurch aus, dass er tendenziell intimer ist als das herkömmliche Radio: Indem beim Podcast in der Regel direkt über den Kopfhörer in die Ohrmuschel gesprochen wird, neigen die Macherinnen und Macher dazu, sich für diese Empfangssituation noch intimere Geschichten auszudenken und zu erzählen, als sie es normalerweise tun, wenn sie die große, öffentliche, unbekannte Masse an Radio-Empfängern adressieren. Ob es die einfühlsame Begleitung des sehr intimen Prozesses einer Geschlechtsumwandlung in mehreren Teilen ist, das Portrait der Flucht der eigenen Mutter aus der DDR oder das zwanglose Gespräch am Küchentisch über Gott und die Welt - der Podcast ist das perfekte Medium dafür. Gerade für Letzteres, die ungezwungenen Gespräche, ebenso wie für individuelle Meinungsbekundungen oder Sendungen über extremspezialisierte Nischenthemen eines leidenschaftlichen Fans, braucht man aufgrund günstiger Heimelektronik und Internet auch keine Rundfunkanstalten mehr mit ihren journalistischen Standards, ihrer hochentwickelten Technologie und dem Knowhow ihrer Redakteure, Technikerinnen und Journalisten. Knapp 100 Jahre nach Bertolt Brecht ist jeder Empfänger in der Tat zum potentiellen Sender geworden.
Allerdings: All das hat zwar zu mehr Freiheit geführt aber noch lange nicht zu mehr Gemeinschaft. Ganz im Gegenteil. Dass im Internet jeder senden kann, heißt noch lange nicht, dass er auch gehört wird. Dazu müssten er und seine Sendung schließlich erst einmal gefunden werden, und wer gefunden wird, das bestimmen im Netz nicht mehr Redakteurinnen, sondern vor allem Algorithmen, für die meisten Menschen auf undurchsichtige, unnachvollziehbare Weise. Algorithmen bestimmen auch, wessen Post uns auf der Timeline von Facebook angezeigt wird und uns eventuell veranlasst darauf zu reagieren, mit einem Like, einer plumpen Meinung oder gar einer ausgefeilten Erwiderung. Allein, Relevanz für das Gemeinwesen und dessen Wohl, zum Beispiel in Form einer nachhaltigen, tiefergehenden Debatte zur Migrationspolitik oder dem Klimawandel, ergibt sich daraus nicht automatisch. Auch bei Spotify, dem Musikstreaming-Dienst, der gerne als perfektionierter Nachfolger des Radios gepriesen wird, bestimmen Algorithmen, welche Interpreten und Genres uns entsprechend unseres Geschmacksprofils vorgeschlagen werden, ganz nach dem Amazon-Motto: „Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch jenes gekauft.“ Algorithmen richten die Nutzer der schönen, neuen Online-Dienste immer zielgenauer zu - als reine Konsumenten, als individuelle Zielscheibe, nicht einmal mehr als Angehörige einer ins Visier genommenen Zielgruppe.
Zwar lassen sich im Internet auch neue Formen von Gemeinschaftlichkeit beobachten, im Kontext des kommerziellen Umfelds sogenannter sozialer Netzwerke jedoch vor allem als Filterblasen und Echokammern: in sich geschlossene Gruppierungen, die durch ihre selektive Wahrnehmung und gegenseitige Bestätigung ihr Weltbild und ihre Meinungen erhitzen wie in einem Schnellkochtopf. Individualisierung und in sich geschlossene Zirkel partieller Interessen: Diese strukturellen Tendenzen des digitalen Umbaus unserer Gesellschaften und Medien haben längst auch den Rundfunk ergriffen und durchdrungen. Ihm gegenüber steht jedoch der Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, gemäß Artikel 5 des Grundgesetztes, wonach gebührenfinanzierte Sender im Sinne des Gemeinwohls der Gesellschaft, ihres Erhalts und ihrer Weiterentwicklung, gleichermaßen der Information, Bildung und Unterhaltung verpflichtet sind.
Zentral sind dabei vor allem zwei Aspekte: Die Förderung von Kunst und Kultur und die Bedeutung der Störung. Geht man davon aus, dass Kunst und Kultur nicht Luxus, sondern eine Lebensnotwendigkeit jeder Gesellschaft sind, kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine besondere, doppelte Rolle zu: So dient er einerseits dazu, über Kunst und Kultur, auch die abseitigste, zu berichten und so den öffentlichen Diskurs zu bereichern. Was wäre aus unzähligen Musikerinnen und Musikern geworden, wenn das Radio nicht ihre Songs und Kompositionen gespielt hätte? Wie würden unser Geschmack und unsere Bildung verkümmern, wenn wir uns nicht mehr vom Radio mit ungewohnten Klängen und Gedanken überraschen ließen?
Andererseits ist es zugleich eine zentrale Funktion der gebührenfinanzierten Rundfunkanstalten, Schriftstellerinnen, Musiker, Komponistinnen und Künstler jeder Art durch Aufträge finanziell zu unterstützen. Ohne Rundfunk hätte Karl-Heinz Stockhausen die elektronische Musik nicht maßgeblich voranbringen können, ohne Hörspieladaptionen von Klassikern wie Moby Dick oder Der Mann ohne Eigenschaften, ohne die Förderung medienkünstlerischer Experimente, ohne die Aufträge an unbekannte Autorinnen und Autoren und die dadurch gegebenen Chancen, sich finanziell über Wasser zu halten und zugleich bekannt zu werden, wäre unser geistiges Leben um ein vielfaches ärmer, stumpfer, deprimierender. Überspitzt gesagt gehören die Förderung von Kunst und Kultur und der Bildungsauftrag heute vielleicht sogar zu den wichtigsten Aufgaben des Rundfunks. Informieren kann man sich auch in der Zeitung und Unterhaltung findet sich im Internet ohne Ende. Infinite Jest, Unendlicher Spaß. Längst ist es kein Problem mehr, sich zu Tode zu amüsieren.
Was die Förderung von Kunst und Kultur so lebenswichtig macht, nämlich deren Potential zur Störung unserer eingefahrenen Weltbilder, zur Erweiterung unseres Horizonts und Erfrischung unserer Sinne durch neue Eindrücke, Ideen und Perspektiven, korrespondiert mit einem besonderen Aspekt des analogen Radios: Seinem intimen Verhältnis zur Störung. So sind die Frequenzen der Radiowellen nicht nur selber anfällig für Störungen jederart und jederzeit, beispielsweise durch Veränderungen des Wetters oder durch Hindernisse wie Tunnel, Berge und Gebäude. Radio ist auch das Kommunikationsmedium par excellence bei gesamtgesellschaftlichen Störfallen wie einer Naturkatastrophe, einem Reaktorunglück oder einem politischen Putsch. Auch wenn die Stromversorgung zusammenbricht bleibt analoges Radiohören möglich.
Entsprechend weist zum Beispiel das schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz neben den Sirenen zur Alarmierung der Bevölkerung auf die besondere Bedeutung des Radios für die Information im Katastrophenfall hin. Und das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät den Bürgern, als „Hauptwarnmittel“ immer ein „batterie- bzw. akkubetriebenes Rundfunkgerät und Reservebatterien oder ein Kurbelradio“ im Haus zu haben. Daran haben DAB, Online-Radio und Podcast bisher nichts geändert und werden es auch in Zukunft nicht tun. Das analoge Radio ist das ressourcenärmste, demokratischste und effizienteste elektronische Massenmedium, das wir haben. Dies zu vergessen oder zu verschenken, geblendet von den Verheißungen der Digitalisierung, wäre mehr als fatal.
Das Radio mag noch so oft totgesagt werden: Lang lebe das Radio!
Von Ania Mauruschat
1921, kurz vor seinem Tod, verfasste der russische Avantgarde-Dichter Velimir Chlebnikov einen euphorischen Text über das damals neueste Medium und seine Verheißungen. „Radio der Zukunft“ heißt dieses Manifest, in dem Chlebnikov u.a. überschwänglich ein Geschmacks- und Geruchsradio imaginiert, das irgendwann sogar den „Honigduft einer Linde“ vermischt mit dem „Geruch des Schnees“ übertragen und so den Radioempfängern in der russischen Steppe den härtesten Winter versüßen werde. Was den Dichter jedoch am meisten an diesem Medium fasziniert, ist seine soziale Dimension. Chlebnikov schwärmt von Radiolesesälen, Radiohörsälen und Radioklubs. Er ist davon überzeugt, dass der „große Zauberer“, wie er das Radio nennt, - Zitat - „die Glieder der Weltseele schmieden und die Menschheit zu einer Einheit verschmelzen“ werde.
Dieses soziale Moment, die Herstellung einer neuen Art von Gemeinschaft, die mit dem Radio möglich geworden war, faszinierte von Anfang an auch andere Künstler. Sie liegt z.B. auch Bertolt Brechts Überlegungen zu einer Radiotheorie zugrunde, wenn der Dramatiker und Lyriker fragt wie man den Distributionsapparat in einen echten Kommunikationsapparat verwandeln könne, so dass jeder Empfänger auch zum Sender werde. In seinem Hörspiel „Der Lindberghflug“ (später umbenannt in „Der Ozeanflug“), das Brecht gemeinsam mit den Komponisten Kurt Weill und Paul Hindemith schrieb, und das 1929 in Baden-Baden uraufgeführt wurde, ging es genau darum: Das Potential des neuen Mediums Radio in Sachen Interaktivität und Gemeinschaftlichkeit zu erforschen und auszutesten. So wurden die Hörer z.B. nicht mehr, wie bisher v.a. im Theater, als passive Empfänger angesehen, sondern aktiviert und zu einander in Beziehung gesetzt, u.a. dadurch, dass sie zu Hause vor ihren Empfangsgeräten die fehlenden Textpassagen sprechen oder das fehlende vierte Instrument eines Quartetts spielen sollten.
Rund 100 Jahre später sieht die Realität des Radios anders aus: Statt „Honigduft der Linde“ sendet es Werbung für Lindenhonig, anstatt den Geruch von Schnee zu übertragen, informiert es über das Schmelzen der Polkappen in Zeiten der Klimakatastrophe. Radio wird v.a. vereinzelt und individualisiert gehört, ob im Bad, in der Küche oder im Auto. Die Digitalisierung verstärkt insbesondere diese Tendenz zum perfektionierten, reibungslosen, individualisierten und effizienten Konsum. Dank DAB, Digital Audio Broadcasting Technologie, gibt es keine Funklöcher mehr im Autobahntunnel, dank Podcast ist niemand mehr an eine Sendezeit gebunden. Jeder kann sich jederzeit die verpasste Folge oder alle Teile einer Sendung auf einmal aus dem Internet herunterladen und über Kopfhörer z.B. beim Pendeln in der U-Bahn hören, um so auch noch das letzte Zeitfenster in einem durchgetakteten Arbeitstag optimal zu füllen und auszunutzen.
Dabei zeichnet sich der Podcast als neue Kunstform der Hörspiel- und Feature-Abteilungen dadurch aus, dass er tendenziell intimer ist als das herkömmliche Radio: Indem beim Podcast in der Regel direkt über den Kopfhörer in die Ohrmuschel gesprochen wird, neigen die Macherinnen und Macher dazu, sich für diese Empfangssituation noch intimere Geschichten auszudenken und zu erzählen, als sie es normalerweise tun, wenn sie die große, öffentliche, unbekannte Masse an Radio-Empfängern adressieren. Ob es die einfühlsame Begleitung des sehr intimen Prozesses einer Geschlechtsumwandlung in mehreren Teilen ist, das Portrait der Flucht der eigenen Mutter aus der DDR oder das zwanglose Gespräch am Küchentisch über Gott und die Welt - der Podcast ist das perfekte Medium dafür. Gerade für Letzteres, die ungezwungenen Gespräche, ebenso wie für individuelle Meinungsbekundungen oder Sendungen über extremspezialisierte Nischenthemen eines leidenschaftlichen Fans, braucht man aufgrund günstiger Heimelektronik und Internet auch keine Rundfunkanstalten mehr mit ihren journalistischen Standards, ihrer hochentwickelten Technologie und dem Knowhow ihrer Redakteure, Technikerinnen und Journalisten. Knapp 100 Jahre nach Bertolt Brecht ist jeder Empfänger in der Tat zum potentiellen Sender geworden.
Allerdings: All das hat zwar zu mehr Freiheit geführt aber noch lange nicht zu mehr Gemeinschaft. Ganz im Gegenteil. Dass im Internet jeder senden kann, heißt noch lange nicht, dass er auch gehört wird. Dazu müssten er und seine Sendung schließlich erst einmal gefunden werden, und wer gefunden wird, das bestimmen im Netz nicht mehr Redakteurinnen, sondern vor allem Algorithmen, für die meisten Menschen auf undurchsichtige, unnachvollziehbare Weise. Algorithmen bestimmen auch, wessen Post uns auf der Timeline von Facebook angezeigt wird und uns eventuell veranlasst darauf zu reagieren, mit einem Like, einer plumpen Meinung oder gar einer ausgefeilten Erwiderung. Allein, Relevanz für das Gemeinwesen und dessen Wohl, zum Beispiel in Form einer nachhaltigen, tiefergehenden Debatte zur Migrationspolitik oder dem Klimawandel, ergibt sich daraus nicht automatisch. Auch bei Spotify, dem Musikstreaming-Dienst, der gerne als perfektionierter Nachfolger des Radios gepriesen wird, bestimmen Algorithmen, welche Interpreten und Genres uns entsprechend unseres Geschmacksprofils vorgeschlagen werden, ganz nach dem Amazon-Motto: „Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch jenes gekauft.“ Algorithmen richten die Nutzer der schönen, neuen Online-Dienste immer zielgenauer zu - als reine Konsumenten, als individuelle Zielscheibe, nicht einmal mehr als Angehörige einer ins Visier genommenen Zielgruppe.
Zwar lassen sich im Internet auch neue Formen von Gemeinschaftlichkeit beobachten, im Kontext des kommerziellen Umfelds sogenannter sozialer Netzwerke jedoch vor allem als Filterblasen und Echokammern: in sich geschlossene Gruppierungen, die durch ihre selektive Wahrnehmung und gegenseitige Bestätigung ihr Weltbild und ihre Meinungen erhitzen wie in einem Schnellkochtopf. Individualisierung und in sich geschlossene Zirkel partieller Interessen: Diese strukturellen Tendenzen des digitalen Umbaus unserer Gesellschaften und Medien haben längst auch den Rundfunk ergriffen und durchdrungen. Ihm gegenüber steht jedoch der Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, gemäß Artikel 5 des Grundgesetztes, wonach gebührenfinanzierte Sender im Sinne des Gemeinwohls der Gesellschaft, ihres Erhalts und ihrer Weiterentwicklung, gleichermaßen der Information, Bildung und Unterhaltung verpflichtet sind.
Zentral sind dabei vor allem zwei Aspekte: Die Förderung von Kunst und Kultur und die Bedeutung der Störung. Geht man davon aus, dass Kunst und Kultur nicht Luxus, sondern eine Lebensnotwendigkeit jeder Gesellschaft sind, kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine besondere, doppelte Rolle zu: So dient er einerseits dazu, über Kunst und Kultur, auch die abseitigste, zu berichten und so den öffentlichen Diskurs zu bereichern. Was wäre aus unzähligen Musikerinnen und Musikern geworden, wenn das Radio nicht ihre Songs und Kompositionen gespielt hätte? Wie würden unser Geschmack und unsere Bildung verkümmern, wenn wir uns nicht mehr vom Radio mit ungewohnten Klängen und Gedanken überraschen ließen?
Andererseits ist es zugleich eine zentrale Funktion der gebührenfinanzierten Rundfunkanstalten, Schriftstellerinnen, Musiker, Komponistinnen und Künstler jeder Art durch Aufträge finanziell zu unterstützen. Ohne Rundfunk hätte Karl-Heinz Stockhausen die elektronische Musik nicht maßgeblich voranbringen können, ohne Hörspieladaptionen von Klassikern wie Moby Dick oder Der Mann ohne Eigenschaften, ohne die Förderung medienkünstlerischer Experimente, ohne die Aufträge an unbekannte Autorinnen und Autoren und die dadurch gegebenen Chancen, sich finanziell über Wasser zu halten und zugleich bekannt zu werden, wäre unser geistiges Leben um ein vielfaches ärmer, stumpfer, deprimierender. Überspitzt gesagt gehören die Förderung von Kunst und Kultur und der Bildungsauftrag heute vielleicht sogar zu den wichtigsten Aufgaben des Rundfunks. Informieren kann man sich auch in der Zeitung und Unterhaltung findet sich im Internet ohne Ende. Infinite Jest, Unendlicher Spaß. Längst ist es kein Problem mehr, sich zu Tode zu amüsieren.
Was die Förderung von Kunst und Kultur so lebenswichtig macht, nämlich deren Potential zur Störung unserer eingefahrenen Weltbilder, zur Erweiterung unseres Horizonts und Erfrischung unserer Sinne durch neue Eindrücke, Ideen und Perspektiven, korrespondiert mit einem besonderen Aspekt des analogen Radios: Seinem intimen Verhältnis zur Störung. So sind die Frequenzen der Radiowellen nicht nur selber anfällig für Störungen jederart und jederzeit, beispielsweise durch Veränderungen des Wetters oder durch Hindernisse wie Tunnel, Berge und Gebäude. Radio ist auch das Kommunikationsmedium par excellence bei gesamtgesellschaftlichen Störfallen wie einer Naturkatastrophe, einem Reaktorunglück oder einem politischen Putsch. Auch wenn die Stromversorgung zusammenbricht bleibt analoges Radiohören möglich.
Entsprechend weist zum Beispiel das schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz neben den Sirenen zur Alarmierung der Bevölkerung auf die besondere Bedeutung des Radios für die Information im Katastrophenfall hin. Und das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät den Bürgern, als „Hauptwarnmittel“ immer ein „batterie- bzw. akkubetriebenes Rundfunkgerät und Reservebatterien oder ein Kurbelradio“ im Haus zu haben. Daran haben DAB, Online-Radio und Podcast bisher nichts geändert und werden es auch in Zukunft nicht tun. Das analoge Radio ist das ressourcenärmste, demokratischste und effizienteste elektronische Massenmedium, das wir haben. Dies zu vergessen oder zu verschenken, geblendet von den Verheißungen der Digitalisierung, wäre mehr als fatal.
Das Radio mag noch so oft totgesagt werden: Lang lebe das Radio!
Lang lebe das Radio!
#4487 / O-Ton / ohne Geodaten / Dokublog
