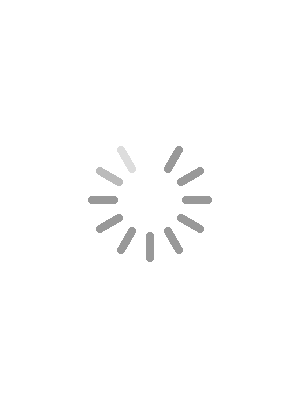
Radio Days (1)
18.09.2014

Ich habe mal, nach der „Wende“ war’s, eine Reihe von Veranstaltungen in der Berliner „Kulturbrauerei“ gemacht: „Erzähltes Leben“, habe dort illustre Gäste aus Ost und West eingeladen und mit ihnen über ihre höchst unterschiedlichen Biographien gesprochen. Keiner aber, der sich in diesem Zusammenhang nicht an die Stimmen aus seinem Radio erinnerte, an Hörspiele, Konzerte, Nachrichten, die ihm mitunter Ohren und Augen öffneten. Ihm auch radiophone Welten bauten, die ihm Heimat wurden. Mag sein, das Radio gerät heute zunehmend zur coolen Informations- und Musikmaschine, doch ist das längst nicht alles, das Radio hat einen festen Grund, der nicht verloren ist, der bleibt, der Bedeutung hat und auch mein Anfang war, von dem ich in meinem Blog erzählen will. Nennen wir ihn: „Radio Days!“
Nichts ist wahrer. In den 50er-Jahren war es tatsächlich das Radio, das mich aus Angst, Unsicherheit und Einsamkeit rettete. Erst recht dann, wenn ich von der Grundschule nach Hause kam, die damals „Volksschule“ hieß und an der Lehrer unterrichteten, die noch „Zucht und Ordnung“ kannten. Mit deren Strafen im Nacken kam ich oft ziemlich geduckt nach Hause... und niemand war da, wie immer: mein Vater saß wieder mal in der Kneipe und meine Mutter verbrachte ohnehin die meiste Zeit bei Oma Frieda. Immer flüchtete sie mit meinem kleinen Bruder in die Arme ihrer Mutter, wenn es ihr mit meinem „Alten“ zuviel wurde. Ich aber galt ihr als „Vaterkind“, musste daheim bleiben, einkaufen und schon früh ein „richtig großer Junge“ sein. Also war ich brav, schmierte mir nach der Schule Stullen mit „guter Butter“ oder kochte mir eine von diesen Maggi-Pulversuppen aus der Schachtel: Erbsensuppe, Linsensuppe, Tomatensuppe. Sofort nach dem Essen hockte ich mich auf den Teppich im Wohnzimmer vor meinen Wunderkasten. Irgendwann hatte mein Vater diesen Apparat gebraucht gekauft: Ein „Telefunken Andante S“ mit beleuchteter Senderskala, UKW-Empfang und einem magisch grün leuchtenden Auge, das nie aufhörte mich anzuschauen. Ein Auge, das über mich wachte und mit irgendeinem Zauber, den ich nicht verstand, dafür sorgte, daß ich immer wieder die Erkennungsmelodie vom NDR-Kinderfunk hören konnte - solange, bis ich sie pfeifen konnte.
Diese Melodie pfiff ich vor mich hin, wenn ich auf dem Hinterhof spielen ging. Und die anderen Kinder pfiffen mit, ....den Kinderfunk kannten sie alle. Doch über die Magie des grünen Auges traute ich mich nicht zu reden, auch nicht darüber, daß mir das Auge manchmal zuzwinkerte und mich alles hören ließ, was ich wollte. Auch am Sonntag. Auch die Geschichten von Kalle. Ich erinnere mich genau: "Alle Leute sprechen davon in jeder Stadt, es gibt kein Verbrechen, das aufgeklärt nicht hat: Kalle Blomquist der Meisterdetektiv, Kalle Blomquist der Meisterdetektiv!"
Yeah! Es war ein wunderbares Wunder. Ich brauchte nur am Sendeknopf zu drehen und schon erzählte mir jemand etwas. Manchmal allerdings auch Geschichten, die ich nicht recht verstand oder die mich verwirrten: "...Rüthel, Wiethold, Pole, 30 Jahre alt, geboren in Warschau, verhaftet im Oktober 44, nach Groß-Rosen gebracht , gesucht von seinem Sohn: Rüthel, Pjotr....Sie hörten den Suchdienst!"
Das war schwer zu begreifen: Söhne suchten ihre vermissten Väter. Frauen ihre Männer. Immer noch. Daß es einen Krieg mit vielen Toten gegeben hatte, das wusste ich. Und daß mein Vater mit nur achtzehn Jahren Sanitäter in Russland gewesen war und im Lazarett Verwundete verrecken sehen musste, das hatte er mir selbst erzählt. Mehr nicht. Ich war noch nicht geboren, als er 1945 aus Leningrad zurückkam und zu trinken anfing. Weit mehr als zehn Jahre später, suchte ich, das Schulkind, noch spät am Abend in der Kneipe nach meinem Vater, flehte, daß er nach Hause kommt. Wozu er sich dann irgendwann auch überreden ließ. Kam also mit nach Hause, schwankend, torkelnd, an meiner kleinen Hand: mein Vater, dieser große Mann, der mir sehr viel später, nur einmal und nur kurz, erzählte, daß er in Russland mit dieser „verfluchten“ Knochensäge Arme und Beine amputieren musste. Danach überall Blut. Und diese verdammten Schreie. Er hörte sie noch immer. Nein, mein Vater hatte wirklich nichts mit den „Pappis“ aus der Radiowerbung zu tun, überhaupt nichts:
"(Mädchen) Weißt Du, wenn Papi nach Hause kommt, und macht so ein ernstes Gesicht, dann nimmt er die Flasche Du... (Mutti) Dujardin! (Mädchen) ...und trinkt ein Gläschen. Dann schnuppert er mit der Nase, zwinkert mit den Augen und sagt: Ach, der ist wundervoll! Das muss doch was Schönes sein! (Mutti) Da hast Du recht, Dujardin ist auch etwas Schönes!"
Ich mißtraute dieser Werbung. Erstens trank mein Vater nicht nur „e i n“ Gläschen und zweitens nannte ihn meine Mutter damals oft genug „Suffkopp“. Gerade auch dann, wenn er seine Stammtischbrüder nach Hause einlud, um nachmittags mit ihnen ein Fußballspiel im Radio zu hören. Da gab es vorher jedes Mal Streit, der immer lauter wurde - Türen knallten und am Ende setzte meine Mutter den kleinen Bruder in den Kinderwagen und schob wieder ab zu Oma Frieda. Wütend war sie. Und wird wohl unterwegs kaum stehen geblieben sein. Auch nicht vor dem großen Schaufenster unseres alten Rundfunkgeschäfts. Da hätte sie hören können, daß Radios quicklebendig sind und richtig sprechen können. Vielleicht wäre die Werbung, die dort aus dem Außenlautsprecher tönte, ein klitzekleiner Trost für sie gewesen:
"Hallo, gnädige Frau, gestern sind Sie an mir vorübergegangen, Ihre schönen Augen haben mich gestreift, seitdem stehe ich hier und warte auf Sie. Ich bin der Rundfunkempfänger ‚Schaub-Kongress’, ich habe sechs Kreise, drei Doppelröhren mit sechs Funktionen, drei Wellenbereiche und meine Skala ist bereits für UKW geeicht. Ich bin noch zu haben, gnädige Frau!"
Von wegen. Wir blieben bei unserem „Andante S“, blieben troy. Bis irgendwann, Sie ahnen es schon, diese aufgetakelte Phonotruhe zu uns ins Haus kam……(Fortsetzung folgt)
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
