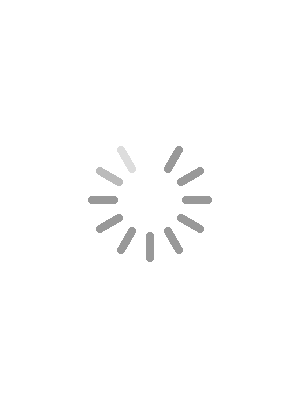
Uwe Kammann
Hörspiele in Zukunft

Das Radio konnte unglaublich visuell sein. Vor allem mit dem magischen Auge, einer runden Anzeige im Empfangsgerät, deren hell- und dunkelgrüne Segmente sich in den Proportionen veränderten, je nachdem, wie genau der Sender eingestellt war. Es war insofern Indikator für Trennschärfe, für punktuelles Herausheben. Damit war diese uns Kinder faszinierende Zauberei natürlich ganz nah an der ursprünglichen technischen Anordnung des Radios – indem es dieses Wort ins Anschauliche übersetzte, das im Kern der Bedeutung für eines steht: den Strahl. Jenen Strahl also, den man sich nicht nur gradlinig vorstellen durfte, sondern der aus Schwingungen bestand, die von einer Quelle ausgingen und von jenen wahrzunehmen war, die für diese Schwingungen empfänglich waren. Sender, Empfänger: eine sensible, in den Anfangszeiten auch eine sehr kostbare Beziehung – denn die Sender, die zu empfangen waren, gehörten zu den Raritäten. Und damit wurden auch die Inhalte, welche diese Schwingungen transportierten, zu Kostbarkeiten; auch dann, wenn sie, für sich betrachtet, nicht immer so kostbar waren. Aber ihre Seltenheit - eine relative Seltenheit natürlich -, verlieh ihnen einen gewissen Adel. Sich dieser Empfänglichkeit hinzugeben, das hieß natürlich auch, sich über das Hören mit Kulissen der Deutung zu umgeben. Diese tonale Einkleidung der Biografie wurde einmal mit der unübertrefflich schönen Formel bedacht: „Tonspur für das Lebenskino“. Was in der Kombination natürlich auch heißt, eine Hierarchie der Wahrnehmung abzulehnen und nicht Töne gegen Bilder auszuspielen. Dass es Unterschiede gibt, ist natürlich klar. Bildeindrücke fließen, wenn es mehr als 24 verschiedene in der Sekunde sind, zu einem Ganzen zusammen. Das Ohr hingegen kann wesentlich mehr Einzelelemente unterscheiden – was, in der Synthese, die Wahrnehmungen stärker differenziert. Zusammen aber wird daraus immer ein innerer Raum der Imagination – ein Wort, das steht für die Einbildung, die In-Eins-Bildung. Eine solche Imagination kann, in den schönsten Momenten, ungeheuer kostbare Räume schaffen. Dann vor allem, wenn diese Momente rar sind. Im Radio sind dies auch immer noch jene, die sich einem geradezu klassischen Sektor verschrieben haben, dem Hörspiel. Unvergesslich ist mir jener Moment des vollkommenen Glück, als die Töne eines Hörspiels von Ror Wolf erklangen, das die Geschichte des Jazzmusikers Bix Beiderbecke erzählt. Was der Autor seinem Helden zudichtet, das gilt in gleichem Maße für dieses Stück selbst: „Jeder Ton für sich genommen war schon schön – aber diese Folge von Tönen war einfach unbegreiflich.“ Alles wirkt leicht, unangestrengt, traumwandlerisch sicher – ganz wie das beschworene Musikideal dieser Radioballade. Heute ein Radio-Ding der Unmöglichkeit, die Intensität eines solchen Augenblicks zu empfinden und auszukosten? Nein, natürlich nicht. Es wird weiter Hörstücke geben, um es ganz neutral zu sagen, die wunderbar gearbeitet sind, denen sich äußerste Sorgfalt, Phantasie, Erzähllust, Darstellungskraft abhören lassen. Es wird weiter Beiträge ganz unterschiedlicher Art geben, die den Hörer beschenken, die ihm bereicherte Zeit vermitteln, statt einfach Lebenszeit in sich aufzusaugen. Allein, ihre Stellung wird sich verändern – weil das Radio nicht mehr an das gebunden ist, was lange Zeit seinen Charakter prägte: die Sendung, die Sendungsfolge. Sprich: das, was wir schlicht Programm nennen. Das Lineare, das Komponierte, das speziell Angeordnete und Platzierte: Es wird seinen einladenden Charakter verlieren, aber – andere Seite der Medaille – auch seine Zwangsläufigkeit, seine relative Enge, die immer auch bedeutet: gebunden zu sein in der Zeit. Früher auch im Raum, weil die Geräte eher stationär waren, selbst dort, wo sie bewegt wurden und werden: im Auto. All das ändert sich in einer ungeheuren Beschleunigungsspirale, vorwärtsgetrieben durch die Technik, speziell: die Digitaltechnik. Die in der Signalübermittlung vor allem eines bewirkt: eine Vervielfachung, indem Bilder und Töne zu Datenpäckchen aus Einsen und Nullen verdichtet werden. Und das bedeutet in der heutigen Wirklichkeit: Alle Inhalte kreisen in einem weltumspannenden Netz, das damit zu einem Universalmedium wird. Zu einer Megaplattform, die fast in Echtzeit jeden teilhaben lässt, so er denn will, an dem, was produziert wurde oder gerade produziert wird. Potenziell von jedem, für jeden. So dass wir in der Kommunikationswelt des Jederzeit und des Überall leben, im Prinzip grenzenlos, auch wenn es natürlich Grenzen der Zugänglichkeit gibt, beispielsweise solche des Geldes. Und solche der Zeit, nicht zuletzt auch der Aufmerksamkeit. Ein herkömmlich gebautes Hörstück ist in dieser technisch vollkommen umgekrempelten Welt weniger eine Sendung im ursprünglichen Wortesinne als erst einmal eine hochverdichtete Audiodatei, eine winzige Tonfolge. Sie zirkuliert, verlangt den gezielten Zugriff. Nicht, dass sich der Inhalt verändern würde oder verändern müsste, nein. Aber die ganz andere Orientierung – hoch individuell, auf der Basis ganz anderer Ordnungssysteme -- , sie wird die Qualität der Wahrnehmung verändern. Ständige Verfügbarkeit – so wünschenswert dies beispielsweise auch ist, so in der archivierenden Funktion, die Vergleich und Erinnerung fördert --, ständige Verfügbarkeit führt tendenziell auch immer zu einer Entwertung. Zigtausende von Ton- und Bilddateien kann man in kleinen, ja winzigen Geräten mit sich herumtragen und abspielen, der stets fließende gigantische Datenstrom erlaubt jederzeitigen Zugriff. Das bedeutet auch Freiheit, ja, das erlaubt eine Tonspur für das Lebenskino, die so grenzenlos aufgefächert ist wie die digitale Welt selbst. Was manche vielleicht vermissen werden: Die Überraschung, die Entdeckung, den Zauber des Unerwarteten. Heute leben wir mit vorgegebener Trennschärfe, bei milliardenfachem Angebot, in einer hoch atomisierten Medienwelt. Ach, manchmal träumt man sich doch zurück. In die Zeit, als ein magisches Auge half, das Zauber-Reich der Radiowellen zu durchmessen.
Hörspiele in Zukunft
#1685 / O-Ton / mit Geodaten / Dokublog
Kommentare
Möchten Sie einen Kommentare abgeben? Benutzern Sie Ihren Dokublog Login. Nach dem Login wird hier das Kommentarfeld angezeigt. Hier einloggen ...
